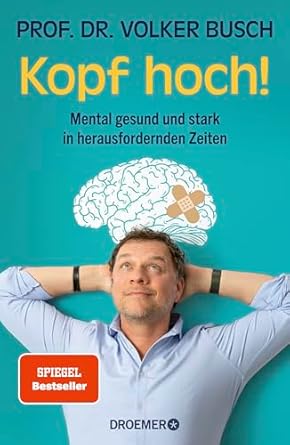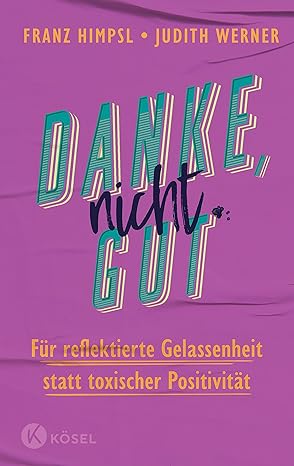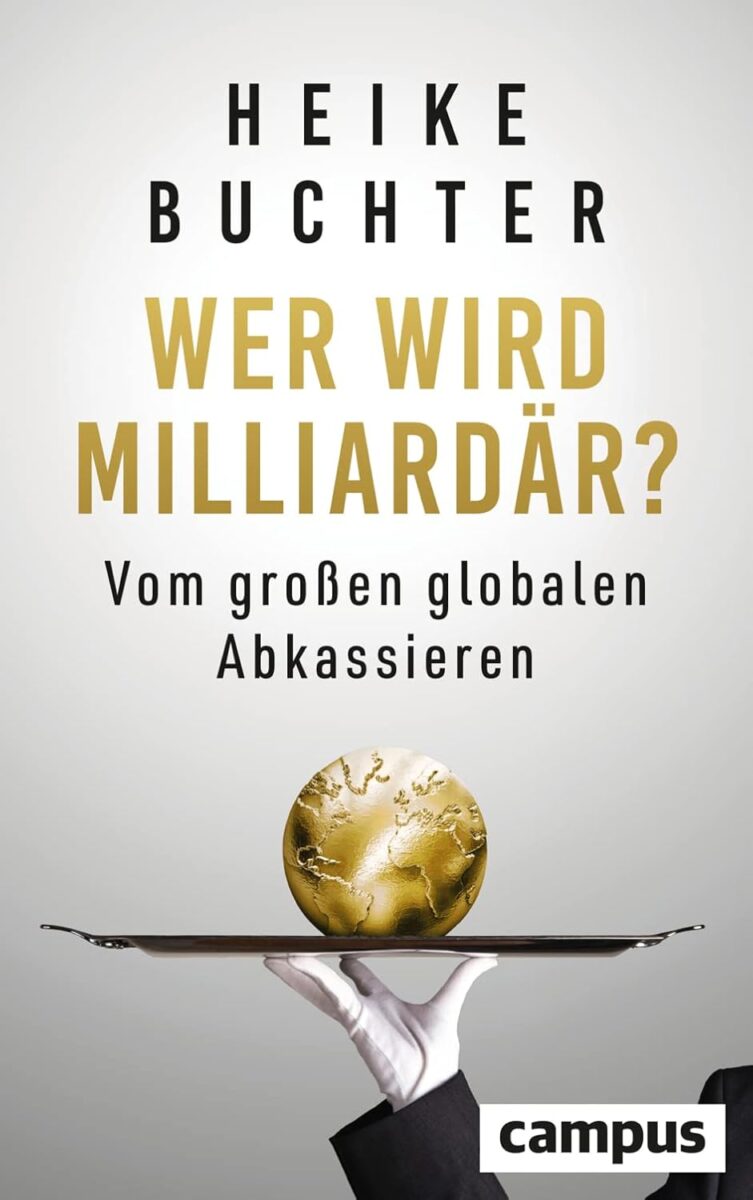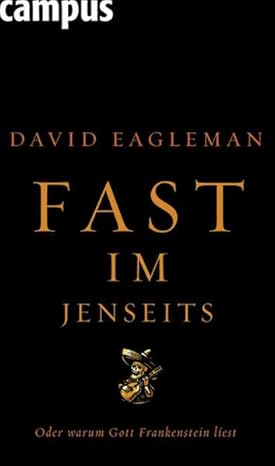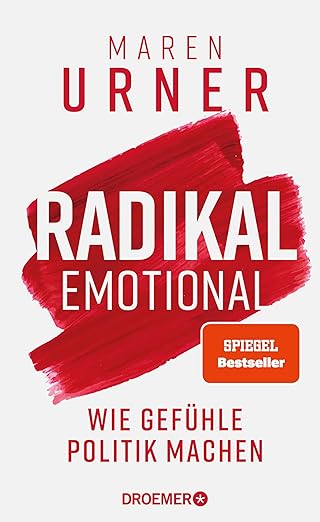In seinem aktuellen Buch liefert der langjährige Verbandsvorsitzende SCHNEIDER (Paritätischer Wohlfahrtverband) eine umfassende Analyse der Sozialpolitik der letzten ca. 5 Jahre.
Er begründet mit dieser Bilanz seine Überzeugung, dass die „Krise“ unserer Gesellschaft nicht nur das (unvermeidbare) Ergebnis externer Herausforderungen ist, sondern auch eine Folge einer verfehlten Sozial- und Wirtschaftspolitik. Diese habe nämlich mit unzureichenden bzw. falsch adressierten Maßnahmen reagiert und so die soziale Spaltung unserer Gesellschaft noch verschärft und neue Gräben aufgerissen. Seine Kernthese lautet dabei: Es mangelte an Gerechtigkeit und Solidarität gegenüber den wirklich Bedürftigen, den Armen.
Zunächst erfolgt eine kritische Betrachtung der Einzelentscheidungen, die seit Beginn der Corona-Pandemie umgesetzt wurden. Gestützt auf umfangreiches Zahlenmaterial entwickelt SCHNEIDER seine Argumentationslinie: In einer Vielzahl von Ausgleichs- und Unterstützungsprogrammen seien – zunächst noch von der Merkel-Regierung – riesige Summen eingesetzt worden, insbesondere um die Wirtschaft zu stabilisieren und Kurzarbeit zu finanzieren. Es werden dann auch alle weiteren Maßnahmen und Hilfsprogramme der Ampel-Regierung im Kontext von Pandemie, Energiepreisentwicklung und Inflation daraufhin überprüft, in welchem Umfang und in welcher Reihenfolge sie jeweils welche Zielgruppen erreicht haben. Auch diese Bilanz – so ist SCHNEIDER ganz sicher – fällt durchweg zuungunsten der Menschen in prekären Lebensverhältnissen aus.
Auf welchem politischen Hintergrund ist das zu erklären?
Hier kommt die Erfahrung des langjährigen Sozialfunktionärs zum Tragen: SCHNEIDER klärt seine Leserschaft ausführlich über die Interessens-, Abhängigkeits- und Machtkonstellationen der Parteien, Verbände und sonstigen Akteure auf, die für die Ausgestaltung der Sozialpolitik in unserer Republik Bedeutung haben. Auch dabei fokussiert er auf die jeweiligen Prioritäten und kommt zu dem Schluss, dass zwar die Arbeitnehmer eine starke Lobby an ihrer Seite haben, die Interessen der auf Transferleistungen angewiesenen Menschen aber oft hintenangestellt werden.
Dabei vergisst er nicht, auf die – seiner Überzeugung nach – skandalösen Versuche hinzuweisen, mit denen wirtschaftsnahe konservative und neoliberale Kreise die Bedürftigkeit mit Begriffen wie „Faulheit“ und „Betrug“ in Verbindung bringen. Dabei ist auch die (erste Phase) der Auseinandersetzung um das Bürgergeld schon Thema.
Auch eine Analyse der – weitgehend erfolglosen – überparteilichen, zivilgesellschaftlichen Initiativen im Bereich der Armutsbekämpfung gehört zu dem von SCHNEIDER gelieferten Gesamtüberblick. Er thematisiert ebenso sein vorübergehendes parteipolitisches Engagement (bei den LINKEN); auch dies liest sich nicht wie eine Erfolgsstory.
Man merkt dem Autor seine Enttäuschung über die ausbleibenden Fortschritte bei der Armutsbekämpfung an; gelegentlich schimmert vielleicht sogar eine Spur Resignation um die Ecke…
Aber SCHNEIDER wäre nicht SCHNEIDER, wenn er an Aufgeben denken könnte. Im Gegenteil: Im Schlussteil seines Buches ruft er alle potentiellen Bündnispartner zum Weiterkämpfen auf und erstellt dafür einen umfangreichen Forderungs- bzw. Maßnahmenkatalog.
Der größte Verdienst dieses faktenreichen und meinungsstarken Buches liegt darin, das ganz grundsätzliche Versagen der wirtschaftlichen und politischen Eliten dieses Landes zu thematisieren. Wie kann es sein, so fragten sich in den letzten Krisenjahren viele und so fragt sich auch SCHNEIDER, dass es keinen ersthaften Versuch gab, den wahrhaft historischen Herausforderungen durch Pandemie, Krieg und Klimawandel mit einem nennenswerten solidarischen Beitrag der Vermögenden und Reichen zu begegnen? Wie kann es sein, dass noch nicht einmal krisenbedingte Sondergewinne zumindest anteilmäßig zur Finanzierung der Bewältigung herangezogen wurden? Wie kann es sein, dass Zahl und Vermögen der Milliardäre in der Krisenzeit noch deutlich zugenommen haben, während die Ärmsten eher mit Almosen abgespeist wurden?
Warum scheint der Gedanke so abwegig zu sein, dass es für diejenigen, die von dem Funktionieren unseres Gemeinwesens mehr als alle anderen profitiert haben, eine Ehre und eine moralische Pflicht darstellen könnte, in solchen Krisen einen Sonderbeitrag zur Bewältigung der Gemeinschaftsaufgaben zu leisten. Warum traut sich (fast) niemand, das einzufordern? Warum gilt es in den einschlägigen Kreisen nicht als „hipp“ und „trendy“, in gesellschaftlichen Notlagen Verantwortung zu übernehmen? Worum denken auch Sie beim Lesen dieser Zeilen zuerst daran, wie blauäugig und naiv solche Gedanken sind? Sind solidarische Gesellschaften bloße Utopie?
Inzwischen ist wohl klargeworden: Dieser Text wurde nicht aus wissenschaftlicher oder journalistischer Perspektive geschrieben. Hier äußert sich einer der wenigen wirklich lautstarken und unermüdlichen Armuts-Lobbyisten, der sich nicht durch parteipolitische Abhängigkeiten die Eindeutigkeit seiner Kritik und seiner Forderungen nehmen lässt. Seine Parteilichkeit steht in keinem Moment in Zweifel, die angeführten Zahlen und Fakten dienen durchweg der Untermauerung seiner Argumentation.
Das ist selbstverständlich legitim und angesichts der geradezu überwältigenden politischen und medialen Schlagkraft der neoliberalen Weltsicht wohl auch mehr als verständlich. Allerdings hat die Eindeutigkeit seiner Position auch einen Preis: Man wird SCHNEIDER kaum zugutehalten können, dass er auch nur einzelne Aspekte einer alternativen Sichtweise zu berücksichtigen oder gar integrieren versucht: Sein Weltbild zeigt keine Risse!
Man hätte sich z.B. in einem Buch, in dem es ganz zentral um Armutsbekämpfung geht, zumindest eine kurze Auseinandersetzung mit verschiedenen Armutsdefinitionen gewünscht, über die im politischen Raum ja durchaus gestritten wird. So wird z.B. immer wieder bezweifelt, ob das (in der Regel zugrunde gelegte) Konzept der „relativen“ Armut wirklich dazu geeignet sei, prekäre Lebenssituationen angemessen zu erfassen.
Der Ansatz, gesellschaftliche Armut über öffentliche Infrastruktur zu bekämpfen, wird zwar kurz genannt, spielt aber in dem Text insgesamt leider kaum eine Rolle. In einer Gesellschaft, die Wohnen, Arbeiten, Bildung, Kultur, Teilhabe und Mobilität anders, also gerechter und für alle gleichermaßen zugänglich organisieren würde, müsste sich die soziale Frage nicht so ausschließlich um die Höhe von Transferleistungen drehen. Wenn alle gesellschaftlichen Gruppen von einem solchen öffentlichen Wohlstand profitieren könnten, würden Einkommensunterschiede zwar nicht verschwinden, deren Bedeutung für die individuelle Lebensqualität aber deutlich abnehmen. Natürlich wäre dies alles auch von einer gerechten und solidarischen Verteilung des insgesamt gesellschaftlich generierten Reichtums abhängig. In der politischen Diskussion würde es aber sicherlich einen großen Unterschied machen, ob es um eine Umverteilung von einem Portmonee ins andere oder um die Gestaltung einer gemeinschaftlichen Daseinsgrundlage ginge.
Vermissen könnte man in diesem Text auch Überlegungen, die über die Logik der bestehenden Sozialsysteme hinausweisen. Zwar wird die Auseinandersetzung über die Transaktionssteuer exemplarisch erwähnt, aber die sich schon abzeichnenden Folgen der durch die KI- und Robotik-Revolution weiter beschleunigten technologische Transformation werden nicht thematisiert. Wer sollte angesichts dieser Dynamik heute noch seriös prognostizieren, wie lange soziale Sicherung noch an individuellen Arbeitsbiografien ausgerichtet werden kann. Es wird notwendigerweise völlig andere Wege geben müssen, gesellschaftlich generierten Reichtum so zu verteilen, dass für alle ein menschenwürdiges Dasein gesichert wird – unabhängig vom jeweiligen Bedarf an menschlichen Arbeitskräften. Eine zukunftsweisende Sozialpolitik müsste hier baldmöglichst Visionen entwickeln, die verhindern, dass sich die Gewinne bis zur Unendlichkeit in den Taschen einer Klasse von Superreichen bzw. den Eignern der Tech-Konzerne sammeln.
So ist das Buch von SCHNEIDER zweifellos eine faktenreiche und extrem informative Bilanz eines erfahrenen und engagierten Insiders. Ein Plädoyer für konsequente Armutsbekämpfung und gerechte Lastenverteilung könnte kaum klarer ausfallen.
Dass in keiner der sozialpolitisch umstrittenen Fragen Spuren von Ambivalenzen oder Zweifel auftauchen, wird vermutlich nur einen kleinen Teil der Leserschaft enttäuschen.
Ein etwas weiterer Blick in die Herausforderungen einer weiter digitalisierten Zukunft wäre sicher eine lohnende Abrundung gewesen.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.