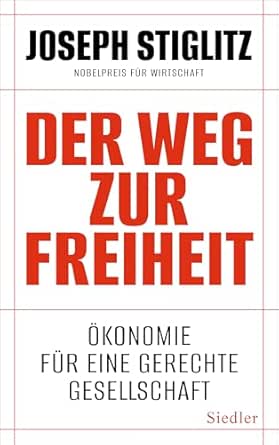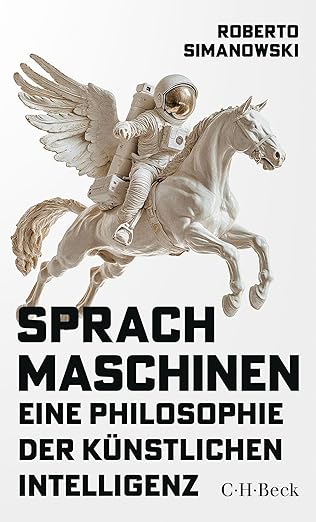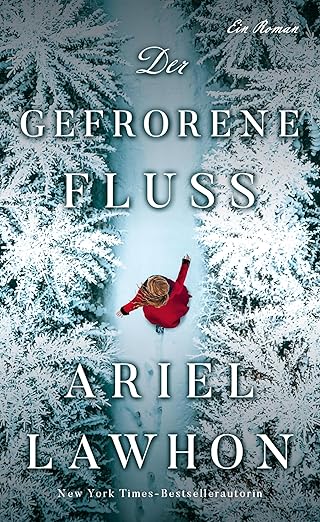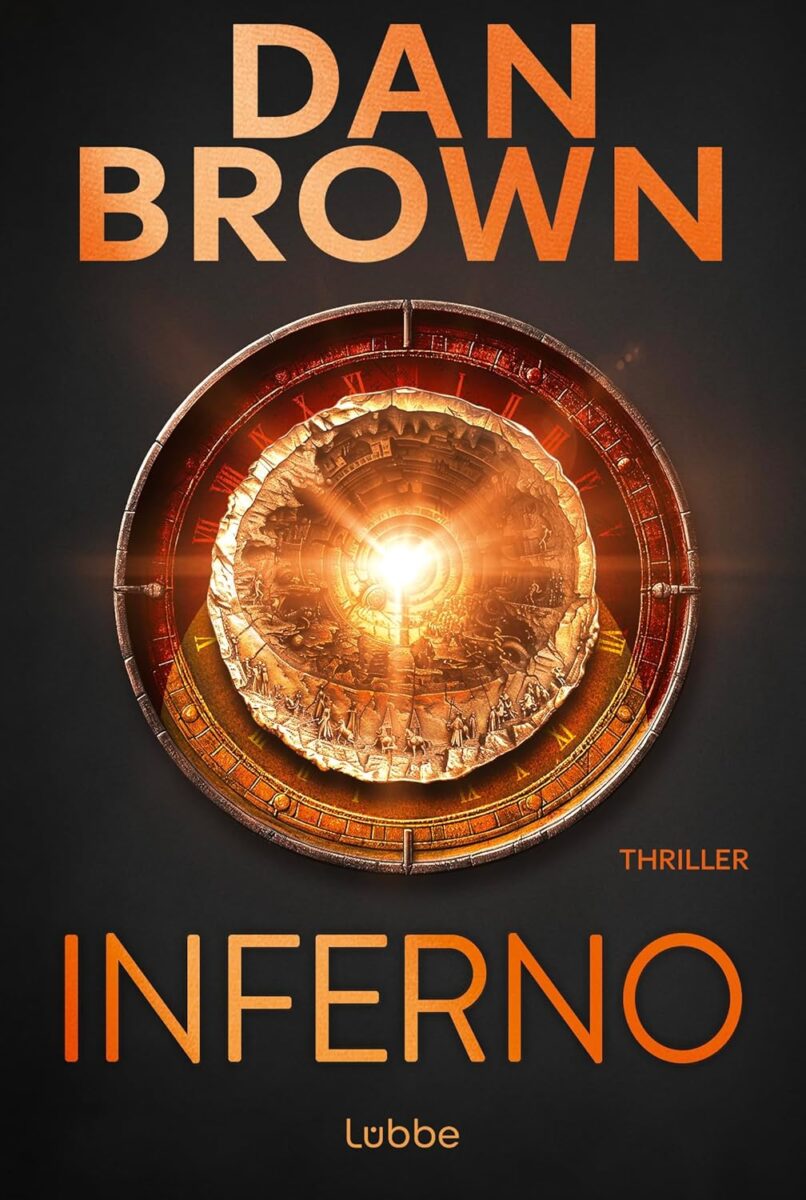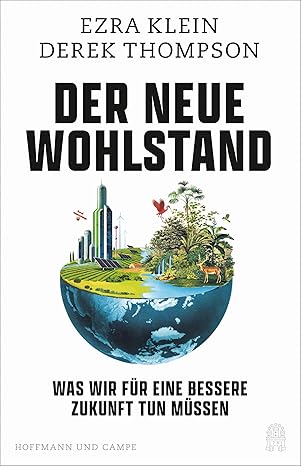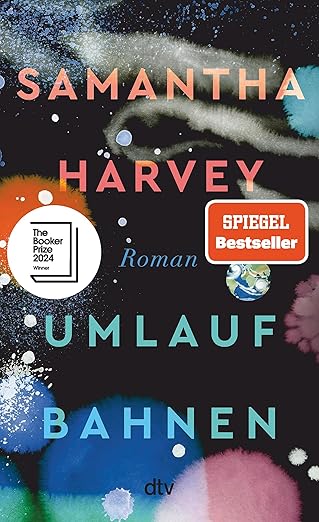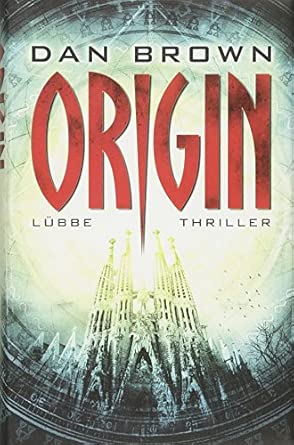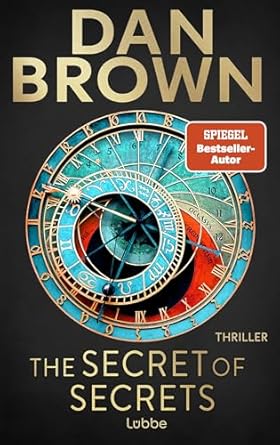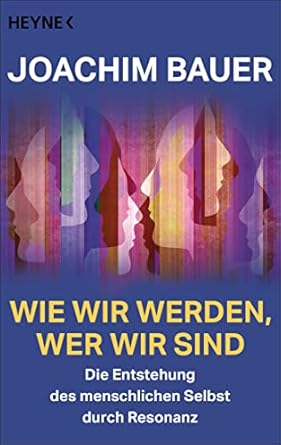Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Dieses Buch ist kein Erziehungsratgeber im klassischen Sinn. Wer konkrete Alltagstipps für das familiäre Zusammenleben erwartet, wird enttäuscht sein – und verfehlt zugleich den Anspruch, den die Autoren mit ihrem Text verfolgen. Herbert Renz-Polster und Ulrich Renz interessieren sich für die großen Zusammenhänge: für den Einfluss frühkindlicher Beziehungserfahrungen auf unsere späteren politischen Haltungen – und damit letztlich für die Frage, wie sich die Demokratie in einer Gesellschaft langfristig erhalten lässt.
Dabei bleibt das Buch nicht bei wohlklingenden Allgemeinplätzen stehen. Vielmehr gelingt es den Autoren, ihre Thesen nachvollziehbar und eindrucksvoll mit einer Vielzahl von wissenschaftlichen Befunden, psychologischen Studien und gesellschaftlichen Beobachtungen zu untermauern. Die Leserinnen und Leser werden nicht belehrt oder ideologisch vereinnahmt – im Gegenteil: Man fühlt sich eingeladen, einem stringenten und überzeugenden Argumentationsweg zu folgen, der von der individuellen Erfahrung bis zur gesellschaftlichen Verantwortung reicht. Ohne dass das Buch je polemisch oder übergriffig wird, macht es dabei eines sehr deutlich: Es geht hier um mehr als um Pädagogik. Es geht um die Zukunft unserer offenen Gesellschaft.
Eine der stärksten Thesen des Buches: Menschen, die in ihrer frühen Kindheit kein verlässliches Beziehungsnetz erleben konnten – die sich allein gelassen, bedroht oder machtlos gefühlt haben – sind später besonders empfänglich für autoritäre Denkweisen. Was oft als „politische Meinung“ erscheint, hat tiefere Wurzeln. Populistische und demokratiefeindliche Haltungen, so das Argument, sind nicht primär das Ergebnis rationaler Überzeugung – sie sind emotionale Reaktionen auf alte Verletzungen. Diese Perspektive verschiebt den Blick – weg von moralisierenden Urteilen über „die da rechts“ hin zu einer tiefergehenden Frage: Wie geht eine Gesellschaft mit den seelischen Biografien ihrer Mitglieder um?
Das zentrale Argument: Kinder, die in frühen Jahren Vertrauen, Resonanz und sichere Beziehungen erleben, entwickeln mit größerer Wahrscheinlichkeit ein demokratisches Selbstverständnis – sie sind weniger anfällig für autoritäre Verlockungen und populistische Vereinfachungen. Umgekehrt kann ein Mangel an emotionaler Sicherheit dazu führen, dass Menschen später nach einfachen Wahrheiten, klaren Hierarchien und harten Abgrenzungen verlangen. Demokratie, so die Autoren, ist nicht nur ein institutionelles Gerüst – sie ist auch ein emotionales Fundament, das in der Kindheit gelegt wird.
All das ist für viele vermutlich nicht völlig neu. Aber die Stärke des Buches liegt auch nicht im revolutionär Neuen, sondern in der Klarheit, Zugänglichkeit und Eindrücklichkeit, mit der dieses Thema aufgearbeitet wird. Wer sich bislang kaum mit den langfristigen Folgen frühkindlicher Erfahrungen beschäftigt hat, findet hier einen hervorragenden Einstieg. Und wer bereits mit diesen Themen vertraut ist, wird die Lektüre dennoch als bereichernd und bestätigend empfinden.
Sprachlich finden die Autoren eine leserfreundliche Mischung zwischen niederschwelliger Führung und wissenschaftlicher Seriosität – so, wie man sich das für ein allgemeinverständliches Sachbuch wünscht.
Am Ende steht ein sehr lesenswertes Buch, das nicht nur informiert, sondern motiviert und ermutigt. Es ist ein Plädoyer für eine Erziehungskultur, die mehr ist als Anpassung und Leistung – nämlich eine Schule der Demokratie, im besten Sinne des Wortes.
Einschränkend sei erwähnt, dass es inhaltlich eine doch sehr große Übereinstimmung mit dem Vorgänger-Buch von RENZ-POLSTER gibt: Wer dieses Buch (“Erziehung prägt Gesinnung“) kennt, kann sich das hier besprochene Buch sparen.
Im Vergleich hat es allerdings Verbesserungen in der Sprache und der Strukturierung gegeben.
Auch dieses Buch hat einen Bezug zu meinem Web-Projekt “WELTVERSTEHEN“:
Die größte Nähe besteht zu der Themenseite “Erziehung und Bildung“. Hier finden Sie die Einbettung in einen größeren Zusammenhang und weitere inhaltliche Hinweise bzw. Anregungen.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.