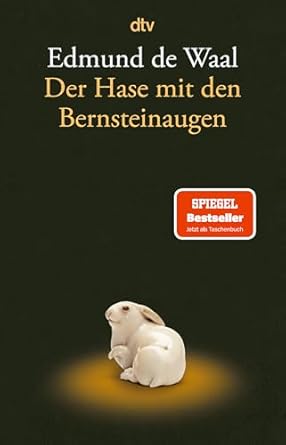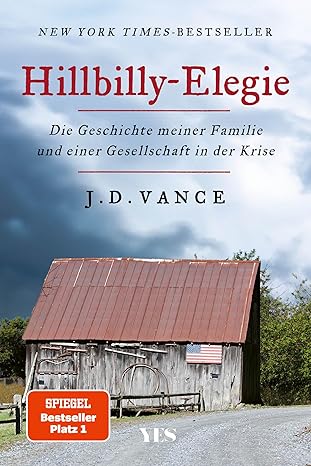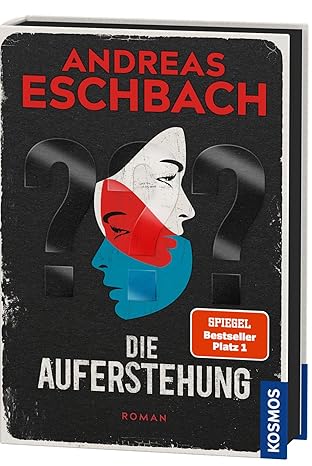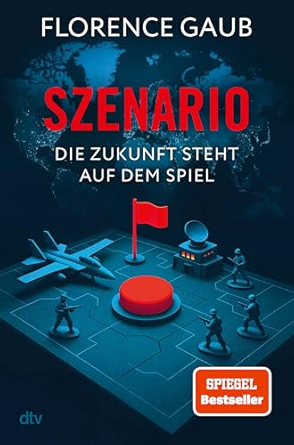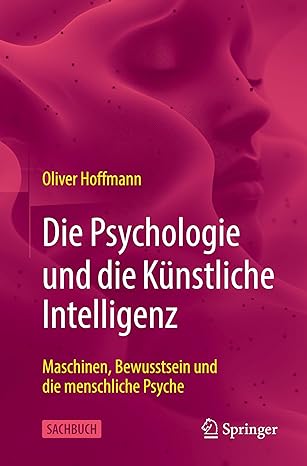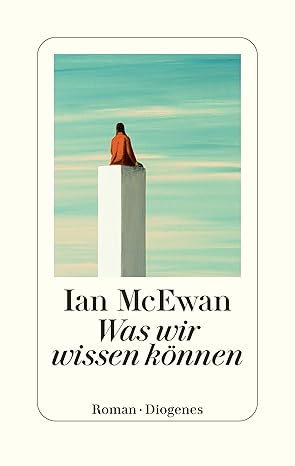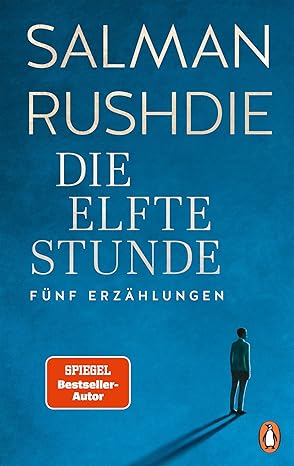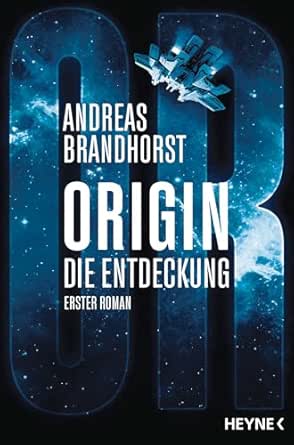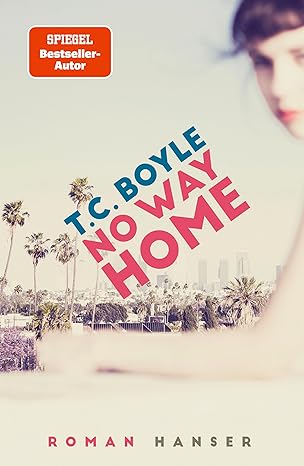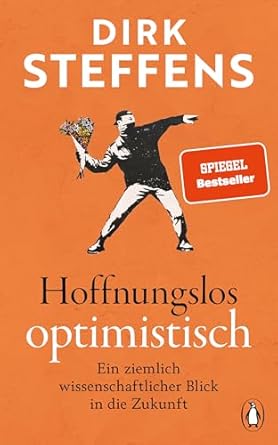
Dieses Buch ist nicht die erste Veröffentlichung des Autors im Themenbereich der Nachhaltigkeit. Auch hier gab es schon diesbezügliche Besprechungen (“Projekt Zukunft“, “ÜberLeben“).
Was ist neu? Was ist anders?
STEFFENS ist ein didaktisch begabter und routinierter Wissenschafts-Journalist. Genau das stellt er auch in seinem neuen Band unter Beweis. Man könnte auch sagen: Er ist ein recht geschickter “Menschen-Fänger”.
In diesem Buch wirft der Autor ein besonderes Netz aus: Es heißt “Optimismus”.
Der Vorteil: Dieses Netz wirkt hell und freundlich – eben nicht bedrohlich.
STEFFENS schafft es in diesem Buch, zwei vermeintlich unvereinbare Ziele miteinander zu verbinden: Er spricht expliziten Klartext bei der Beschreibung der planetaren Zustände und Risiken – und verbreitet gleichzeitig eine Stimmung von Aufbruch und Zuversicht.
Diese Doppelbotschaft drückt schon der Titel des Buches aus: “Eigentlich” befinden sich die meisten unserer planetaren Systeme in einem hoffnungslosen Zustand; und doch gibt es ganz viele Beispiele für Projekte, Initiativen und Innovationen, die dabei helfen könnten, das Ruder noch einmal herumzureißen (und so optimistisch stimmen könnten).
Die Strategie des Autors ist leicht zu erkennen: Er möchte die Lage ganz sicher nicht beschönigen, aber er möchte gegen Resignation und Zynismus anarbeiten. Seine Botschaft: “Engagement lohnt sich weiterhin! Schaut nur mal genauer hin, was alles schon passiert und funktioniert!”
Wenn man sich zum Thema Klima, Artensterben, Umweltzerstörung und Nachhaltigkeit bisher noch nicht näher informiert hat, lernt man in diesem locker und verständlich geschriebenen Sachbuch eine ganze Menge: Ohne dass man es als Leser/in so richtig merkt, streut der Autor einen ansehnlichen Batzen an Informationen in seinen gefälligen Text. Und tatsächlich ist fast nirgendwo ein erhobener Zeigefinger in Sicht! STEFFENS macht es auf die sanfte Tour: Er ist sozusagen der “Anti-Klimakleber”!
Trotzdem könnte der Text doch den einem oder die andere enttäuschen:
Wer in den letzten ca. 10 Jahren die Nachhaltigkeits-Diskussion halbwegs aufmerksam verfolgt hat, erfährt rein faktisch wenig Neues. Wenn man genau hinschaut, richtet sich das Buch an “Einsteiger” in diese Thematik; für diese Zielgruppe ist es allerdings exzellent geeignet!
Ein wenig irritierend mag der von STEFFENS verbreitete Optimismus für diejenigen sein, die sich in diesen – ziemlich verrückten und gefährlichen – Zeiten mit der Gesamt-Weltlage auseinandersetzen. So motivierend auch die technischen und politischen Teileerfolge im Bereich von Energiewende und Klima-/Umweltschutz sein mögen: So richtige Zuversicht könnte wohl nur aufkommen, wenn man alle anderen (geopolitischen, gesellschaftlichen und militärischen) Bedrohungen ausblendet. So ganz passt die Botschaft eben doch nicht in die Landschaft – zumal auch der Roll-Back in der Klimapolitik immer noch an Fahrt aufnimmt.
STEFFENS hat ein nützliches, informatives und sympathisches Buch geschrieben. Schenken Sie es jemandem, den Sie für das Thema Nachhaltigkeit interessieren und gewinnen möchten, ohne zu überfordern oder zu belehren. Es ist eine angenehme Lektüre, die Wissen und Haltung vermittelt.
Der Bezug zu meinem Web-Projekt “WELTVERSTEHEN”:
Die größte Nähe besteht zu der Themenseite “Klimazukunft“. Hier finden Sie die Einbettung in einen größeren Zusammenhang und weitere inhaltliche Hinweise bzw. Anregungen.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.