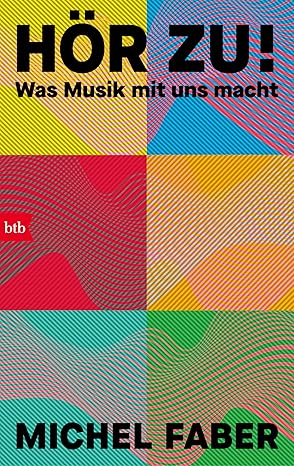
Wenn man über die Anschaffung eines mittleren Wälzers von ca. 550 Seiten zum Thema “Musik” nachdenkt, möchte man vorher eine Ahnung davon haben, auf was man sich einlassen würde.
Die Antwort darauf soll mit einer Aufzählung von Inhalten beginnen, die dieses Buch nicht ausmachen. “Hör zu” ist nämlich keine
– historische Reise durch die Geschichte der Musik
– Einführung in die Musiktheorie
– systemattische Darstellung von Genres oder Stilrichtungen
– Bewertung einzelner Interpreten oder Werke
– Analyse von psychologischen oder neurowissenschaftlichen Prozessen
– soziologische oder ökonomische Betrachtung.
Was bleibt dann, worüber man sich in dieser Breite auslassen kann?
FABER, der zuvor als Romanautor aktiv war, hat ein extrem persönliches Buch über Musik geschrieben. Er macht erst gar nicht den Versuch, aus einem Expertenmodus heraus den Anschein von Allgemeingültigkeit zu erwecken. Er schreibt – eher in einem assoziativen als systematischen Stil – über so ziemlich alles, was ihm als leidenschaftlichen Musikhörer bedeutsam erscheint – und dabei ist Subjektivität sozusagen seine Richtschnur.
Grundlage für seine Ausführungen ist – über seinen privaten Musikkonsum hinaus – seine jahrzehntelange Verbundenheit mit einer Kultur- und Musikszene, die sich wohl ohne Übertreibung als “links-alternativ-progressiv” charakterisieren ließe.
Nicht unerwähnt lässt der Autor auch seine Zugehörigkeit zu einer Spielart der “Neurodiversität” – aber “Normalität” ist für FABER sowieso wohl eher ein abschreckendes Konzept.
Das Buch handelt von den verschiedenen Facetten und Funktionen, die Musik sowohl im persönlichen Leben als auch in der Gesellschaft haben kann: Es geht um Gefühle, um Identität, um Gruppenzugehörigkeit, um Konsum, Geschäft und Marktgesetze, um Abgrenzung, um Selbstfindung, …
Der Versuch einer Gliederung bezieht sich auf Themen wie “frühste musikalische Prägungen”, “die Rolle der Musik in den eigenen Jugenderinnerungen”, “die vermeintliche Überlegenheit der Klassik gegenüber der Pop-Musik”, “die Rolle von Kritikern und Musikzeitschriften”, “die Geschichte und Bedeutung der jeweiligen Speichermedien”, “der (unangemessene) Umgang mit den kulturellen Ursprüngen der Pop-Musik”; “die Männer-Dominanz in der Musikwelt”, “die Bedeutung der Lautstärke”, “die Arroganz der vermeintlichen Experten”, “das Glück des Singens”, usw.
Alle diese Themen werden nicht in der Systematik eines journalistischen Sachbuchs abgearbeitet, sondern in einem rasanten Slalom-Parcours, in dem Hunderte von Interpreten und Songbeispiele zur akustischen Illustration genutzt werden.
Anders als in der Einleitung angekündigt, gibt es natürlich doch klare Präferenzen des Autors – auch wenn er gleichzeitig immer wieder darauf hinweist, dass niemand das Recht habe, anderen einen Musikgeschmack vorzuwerfen.
Es wird z.B. deutlich, dass FABER keinen Zweifel daran hat, dass die kulturellen Beiträge der Beatles, der Beach Boys, eines Bob Dylan oder eines Marvin Gaye hinter dem Vermächtnis der großen Helden der Klassik nicht zurückstehen. Aber natürlich kämpft FABER leidenschaftlich für die verkannten Underdogs der Musikszene, z.B. auch für die Frauen.
Wer sich und sein Leben selbst mit und über Musik definiert, wird früher oder später durch dieses Buch eingefangen – durch Themen, verehrte Interpreten oder Lieblingsstücke.
Man sollte allerdings realistische Erwartungen an diese Hymne an die Musik haben: Ohne persönlichen Bezug zu der Soul-, Beat-, Rock- und Popwelt der letzten 60 Jahre ist dieser große Happen Musikbegeisterung nur schwer zu verdauen. Man muss dem Autor seine manchmal exzentrischen und weitschweifigen Exkurse verzeihen können; man muss Gefallen an seiner ungebändigten Assoziationsdynamik finden.
Dann macht nicht nur Musik etwas mit einem, sondern auch dieses Buch!
