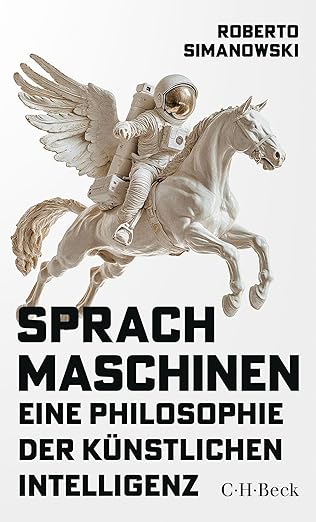
Wenn man sich als relativ Technik-affiner Buchblogger einem aktuellen philosophischen Statement zur KI zuwendet, erwartet man eher eine herausfordernde Leseerfahrung: Liegt es doch – vermeintlich – recht nahe, dass hier mit viel geisteswissenschaftlichem Pathos auf eine kulturpessimistische Art und Weise pauschal gegen die Irrungen und Bedrohungen eines unverantwortlichen Technik-Wahns angekämpft wird.
Kurz gesagt: Man befürchtet eine große Portion Bedenkenträgertum, mindestens jedoch ausgewachsenen Skeptizismus.
Was Roberto SIMANOWSKI hier (im Oktober 2025) vorlegt, spielt allerdings in einer völlig anderen Liga! Mir scheint die Prognose vertretbar, dass hier ein Grundlagenwerk geschaffen wurde, das die gesellschaftliche Diskussion im Bereich der (sprachbezogenen) KI für längere Zeit prägen wird.
Zunächst überrascht der Begriff “Sprachmaschinen” – der ja keineswegs geläufig ist. Der Autor benutzt ihn, um seine Konzentration auf diesen bedeutsamen Teilbereich der Künstlichen Intelligenz zu dauerhaft und unübersehbar zu markieren. Gleichzeitig trägt dieser Begriff auch eine implizite Botschaft: Er erinnert permanent an die zentrale Rolle der Sprache für die Entwicklung der Kultur des Menschen, seiner Erkenntnismöglichkeiten und seines Selbstverständnisses; gleichzeitig verbindet der zweite Wortteil daran, dass die KI in der Entwicklungslinie aller früheren Werkzeuge steht. Genau in der – bis vor kurzem undenkbaren – Verbindung zwischen dem Kern des (geistig-bewussten) Menschseins und der (digitalen) Technologie liegt das revolutionäre Potential, das SIMANOWSKI in seinem Buch in einer bewundernswerten Gründlichkeit durchdringt.
Wer sich mit diesem Buch argumentativ gegen die gesellschaftliche Dominanz und den kulturellen und ökonomischen Machtanspruch des KI-Tsunamis wappnen will, geht in diesem Buch ganz sicher nicht leer aus. Im Gegenteil: Der Text ist prall gefüllt mit differenzierten, sachkundigen und didaktisch gut aufbereiteten Argumentationslinien, die Sand in das gut geölte Getriebe des KI-Hypes schütten können. Es erscheint kaum eine kritische Perspektive denkbar, die vom Autor übersehen wurde.
Allerdings wird hier keine Fastfood-Polemik geboten, die anstrengungslos in das nächste Pausengespräch eingebracht werden könnte. Ein Grund dafür liegt darin, dass SIMANOWSKI kein Eiferer ist, der nur wortreich einen technikbedingten Untergang des Abendlandes zelebrieren wollte. Der Autor zeigt nicht nur seine fachspezifische (philosophische) Fundierung, sondern erweist sich als fachkundiger Kenner relevanter politischer, soziologischer und technikreflexiver Texte bzw. Positionen.
So wie sich der Autor seine differenzierten Betrachtungen ganz offensichtlich gründlich erarbeitet hat, so verlangt auch das Lesen seiner Ausführungen eine gewisse konzentrative Disziplin. Als Belohnung winkt eine Erkenntniserweiterung, die über das Füttern bestimmter vorgegebener Pauschalurteile weit hinausgeht.
Im Zentrum der Analyse stehen Fragen, die der Autor selbst in seinem Ausblick-Kapitel so zusammenfasst:
“Wer spricht eigentlich, wenn die Sprachmaschine spricht? Was bedeutet es für Minderheitenpositionen, wenn die statistische Mehrheit das Sagen hat? Wer treibt der Sprachmaschine das inkorrekte Sprechen aus, zu dem die Statistik sie verführt? Mit welchem politischen Mandat? Wie kann der Mensch der Überredungskunst der Sprachmaschine widerstehen? Warum gibt es überhaupt Sprachmaschinen?”
Was deutlich wird: SIMANOWSKI geht ins Eingemachte. Er schaut sich die konkreten Prozesse und deren Vorgaben und Einbettungen an, sowohl von der technischen Logik, als auch bzgl. der zugrundeliegenden Wertungen und Machtstrukturen.
Dabei ist der Autor zwar unbeirrt kritisch, aber nie polemisch oder gar auf einem Auge blind.
Er will einfach sehr genau wissen (zu Ende denken), was es bedeutet – oder bedeuten könnte – wenn demnächst die von uns gelesenen und gefertigten Texte ganz überwiegend KI-generiert sind. Welche Kompetenzen würden uns verloren gehen? Welchen (zusätzlichen) Manipulationen wären wir ausgesetzt? Wie könnten oder sollten KIs mit kulturspezifischen Werten oder unterschiedlichen politischen Überzeugungen umgehen? Wird alles auf eine statistische Normalität hin nivelliert oder haben wir alle unsere optimal zugeschnittene ganz persönliche KI, die uns immer nach dem Munde denkt und spricht?
Manchmal wechselt SIMANOWSKI von der technologisch-konkreten Ebene auf philosophische Grundsatzfragen – und man findet sich plötzlich bei HEGEL oder KANT wieder. An der nächsten Ecke wartet HARARI oder man schaut eine Szene von “2001: Odyssee im Weltraum”. Langweilig wird es nie, auch nicht platt oder missionarisch.
Im Ausblick wird der Autor geradezu überraschend versöhnlich-optimistisch: Er macht sehr pragmatische Vorschläge hinsichtlich einer “Philosophischen Medienkompetenz”, die – natürlich – das aktive Umgehen mit den Sprachmaschinen beinhalten soll und muss.
SIMANOWSKI will diese modernsten und weitreichendsten Werkzeuge des Menschen weder verdammen noch verbannen; ganz offensichtlich sieht er auch deren Nutzen und Potential für sich und andere.
Wer sich demnächst über Grenzen und Risiken der Sprach-KIs sachkundig und niveauvoll äußern will, wird – so meine Überzeugung- an diesem Aufschlag von SIMANOWSKI kaum vorbeikommen.
Meine Konsequenz: Eines meiner nächsten Bücher wird “Sprachmaschinen” heißen! Ich werde das Buch mit Genuss noch einmal lesen – mit noch mehr Aufmerksamkeit für die Feinheiten…
Auch dieses Buch hat einen Bezug zu meinem Web-Projekt “WELTVERSTEHEN“:
Die größte Nähe besteht zu der Themenseite “KI“. Hier finden Sie die Einbettung in einen größeren Zusammenhang und weitere inhaltliche Hinweise bzw. Anregungen.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.

