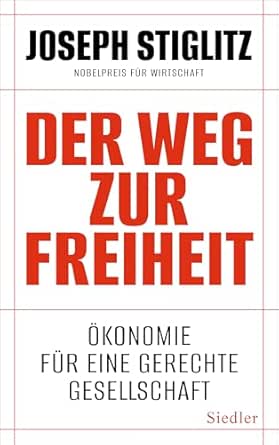
Joseph STIGLITZ, vielfach ausgezeichneter Ökonom und langjähriger Kritiker neoliberaler Marktgläubigkeit, legt mit “Der Weg zur Freiheit” (The Road to Freedom) sein wohl grundlegendstes und persönlichstes Werk vor. Es liest sich wie ein Resümee seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit Wirtschaftssystemen – eine Art ökonomisches Testament. Der Titel ist programmatisch, denn STIGLITZ geht es um nicht weniger als die Rückeroberung des Freiheitsbegriffs. Dieser wurde seiner Ansicht nach zu lange und zu erfolgreich von marktradikalen, neoliberalen Kräften monopolisiert – als „Freiheit von“ statt „Freiheit zu“.
Das zentrale Argument zieht sich konsequent durch alle Kapitel: Freiheit bedeutet nicht Abwesenheit von Staat, sondern die Ermöglichung von Selbstbestimmung durch staatlich garantierte Rahmenbedingungen. Bildung, Gesundheitsversorgung, existenzsichernde Löhne, bezahlbarer Wohnraum, ein wirksames Wettbewerbsrecht und eine aktive Steuerung von (nachhaltigen) Zukunftsinvestitionen – das sind für STIGLITZ keine netten Zugaben, sondern Grundpfeiler einer Gesellschaft, in der Freiheit mehr ist als ein Schlagwort.
Er legt dar, wie in den USA durch Deregulierung, Steuererleichterungen für Reiche und den Abbau öffentlicher Infrastruktur über Jahrzehnte ein System entstanden ist, in dem sich wirtschaftliche und politische Macht gegenseitig verstärken – zum Nachteil der Mehrheit. Besonders drastisch schildert er den Einfluss von Großkonzernen und Superreichen auf Gesetzgebung, Medien und Justiz. Das Ergebnis: Ein wachsender Teil der Bevölkerung verliert nicht nur materielle Sicherheit, sondern auch jede reale Einflussmöglichkeit auf die Gestaltung ihres Lebens.
Seine Forderungen sind dabei ebenso konkret wie weitreichend. So spricht er sich für eine Vermögenssteuer aus, um die zunehmende Konzentration von Reichtum zu begrenzen. Er plädiert für die Stärkung von Gewerkschaften, da diese historisch erwiesenermaßen ein entscheidendes Korrektiv gegenüber Kapitalmacht darstellen. Auch ein öffentliches Gesundheitssystem nach dem Vorbild europäischer Länder wird als Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit und ökonomische Produktivität dargestellt.
Immer wieder betont STIGLITZ, dass wirtschaftliche Freiheit für die Mehrheit nicht im Gegensatz zu staatlicher Regulierung steht – sondern ohne sie schlicht nicht existiert. Seine historische Perspektive ist dabei hilfreich: Er erinnert an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der viele westliche Demokratien gezielt auf Sozialstaatlichkeit, Arbeitnehmerrechte und öffentliche Investitionen setzten – mit enormem ökonomischen Erfolg. Erst mit dem neoliberalen Rollback der 1980er-Jahre (durch Reagan und Thatcher, später auch durch Clinton, Blair und Schröder) sei diese Balance verloren gegangen. Was folgte, beschreibt STIGLITZals „Freiheit für die Märkte, aber nicht für die Menschen“.
Für die europäische Leserschaft – insbesondere aus Ländern mit einer Tradition der sozialen Marktwirtschaft – wirken manche Argumente fast banal. Es braucht keine große Überzeugungskraft, um etwa die Notwendigkeit progressiver Besteuerung oder einer aktiven Wohnungspolitik nachzuvollziehen. Das erklärt auch die vielleicht größte Schwäche des Buches: STIGLITZ argumentiert mitunter stark redundant, wiederholt Kerngedanken bis zum Überdruss und verliert sich in Details, die man hierzulande bereits als gesetzt ansehen könnte. Man merkt: Er schreibt für ein amerikanisches Publikum, das diese Selbstverständlichkeiten vielfach erst wieder (oder überhaupt) entdecken muss.
Und dennoch: Auch in Deutschland oder Europa ist der Rückzug des Staates, die Privatisierung öffentlicher Güter und die Ausweitung prekärer Beschäftigung Realität. Insofern ist die Lektüre keineswegs überflüssig. Im Gegenteil: Sie erinnert daran, dass Freiheit stets neu ausgehandelt werden muss – und dass die Sprache, in der wir über Wirtschaft sprechen, nicht neutral ist.
Der Weg zur Freiheit entfaltet das Bild eines Wirtschaftssystems, das in vielerlei Hinsicht an das Ideal der sozialen Marktwirtschaft anknüpft – erweitert um ökologische Nachhaltigkeit und globale Verantwortung. Es ist ein klar sozialdemokratisch inspiriertes Modell, das sowohl pragmatisch als auch normativ überzeugt. Wer sich für den Zusammenhang von ökonomischer Ordnung und gesellschaftlicher Freiheit interessiert, findet in diesem Buch eine gleichermaßen fundierte wie engagierte Analyse.
Stiglitz’ Buch ist damit nicht nur ein ökonomisches Argumentationsfundament gegen den Neoliberalismus, sondern auch ein Appell an die politische Urteilskraft. Es fordert dazu auf, die wirtschaftliche Ordnung nicht als Sachzwang zu akzeptieren, sondern als gestaltbares Gemeinwohlprojekt zu begreifen. Dass diese Einsicht – gerade in Zeiten globaler Krisen und zunehmender sozialer Polarisierung – alles andere als selbstverständlich ist, macht den Wert dieser Lektüre aus.
Von einem bereits überzeugten Publikum fordert das Lesen allerdings zwischenzeitlich eine fast unzumutbare Toleranz gegenüber Wiederholungen.
Auch dieses Buch hat einen Bezug zu meinem Web-Projekt “WELTVERSTEHEN“:
Die größte Nähe besteht zu den Themenseiten “Freiheit” und “Wirtschaft“. Hier finden Sie die Einbettung in einen größeren Zusammenhang und weitere inhaltliche Hinweise bzw. Anregungen.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.

