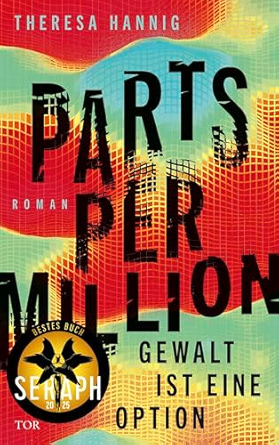
(Achtung: Spoiler-Warnung! Einigen könnten in dieser Rezension die Hinweise auf den Handlungsverlauf zu weit gehen; wer sich den Spannungsbogen in vollem Umfang erhalten möchte, sollte die Rezension vielleicht eher im Nachhinein lesen und mit dem eigenen Eindruck abgleichen.)
Theresa Hannigs neuer Roman “Parts Per Million” knüpft erzählerisch an die reale Situation der Autorin an: Ein Folgeprojekt ihres erfolgreichen Romans („Pantopia“) steht aus, Inspiration ist rar. Dann gerät die Ich-Erzählerin zufällig in eine Protestaktion von Klimaklebern. Was zunächst wie eine bedeutungslose Episode erscheint, entwickelt sich zur Initialzündung für eine weitreichende persönliche Transformation, die das Privat- und Familienleben der Protagonistin völlig durcheinanderwirbelt.
Die Protagonistin tastet sich zunächst neugierig und beobachtend an die Szene heran, beginnt zu recherchieren und lässt sich zunehmend hineinziehen in eine Welt, in der moralische Dringlichkeit und politischer Aktionismus eine explosive Mischung eingehen. In mehreren Stufen wandelt sich ihre Rolle: Von der interessierten Außenstehenden zur aktiven Mitstreiterin bis hin zur zentralen Figur einer radikalisierten Gruppierung, die mit immer drastischeren Mitteln gegen die “Klimakiller” unserer Gesellschaft vorgeht.
HANNIG strukturiert ihren Roman auch als warnende Aufklärung: Jedes Kapitel beginnt mit einer realen, alarmierenden Klimanachricht – ein erzählerisches Stilmittel, das die – unzweifelhafte – Dringlichkeit des Themas betont. Im Zentrum steht jedoch nicht der Klimawandel selbst, sondern die Frage, wie weit Aktivismus gehen darf bzw. vielleicht auch muss.
Zunächst dominiert das Ideal der Gewaltfreiheit, doch mit wachsender Frustration über die Wirkungslosigkeit symbolischer Aktionen verschiebt sich das moralische Koordinatensystem der Gruppe zunehmend. Gewalt wird nicht nur als Mittel zur Aufmerksamkeitserzeugung eingesetzt, sondern auch als eine Art Erziehungsmittel (Strafe) und zur Erzeugung konkreter Angst („ich könnte der Nächste sein“). Wirklich erschreckend ist jedoch die Radikalität, mit der die physische Ausübung der Gewalt als emotional befriedigend beschrieben wird.
An dieser Stelle beginnt der Roman problematisch zu werden. Die Grenzverschiebung in Richtung Gewalt wird erzählerisch kaum kritisch begleitet, sondern nimmt Züge einer geradezu sadistischen Gewaltorgie an.
Zwar wird ganz am Ende ein Kontrollverlust – und somit ein Scheitern der Strategie – dargestellt, eine inhaltliche Reflexion über Schuld, Verhältnismäßigkeit oder moralische Grenzen bleibt aber weitgehend aus. Weder wird diskutiert, inwieweit einzelne Akteure allein durch autonome „Willensentscheidungen“ – also im engeren Sinne „schuldhaft“- zu schädlichem (Klima-)Handeln veranlasst werden, noch ob und wann auch brutalste Gewalt gegen Personen auf einer höheren ethischen Ebene legitimierbar sein könnte.
Auch die Entwicklung der Hauptfigur wirkt da an entscheidenden Stellen konstruiert. Die Entwicklung von einer gutmeinenden und verantwortungsvollen linksliberalen Autorin und Mutter zur brutalen Akteurin in einer klimakämpferischen Terrorzelle bleibt psychologisch wenig überzeugend. Hier fehlt es an innerer Logik und Tiefe, um diese Wandlung wirklich nachvollziehbar zu machen; ohne den Bezug auf entsprechende biografische Prägungen wirkt das Ganze sehr unglaubwürdig.
Was als spannender Beitrag zur Diskussion um Klimaaktivismus begonnen hatte, verliert sich zusehends in einem erzählerischen Extremismus, der mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. “Parts Per Million” ist ein aufrüttelndes, aber letztlich unausgewogenes Buch, das die moralischen Dilemmata des militanten Aktivismus zwar aufgreift, sie aber erzählerisch nicht zu Ende denkt. Die notwendige Balance zwischen Empathie, Analyse und Kritik bleibt auf der Strecke. Vielleicht ist das alles genau so gewollt – aber schwer verdaulich und unausgegoren ist es trotzdem.
Mit viel gutem Willen kann man den Roman zwar durchaus als provokante Mahnung und Warnung vor dem Phänomen des Öko-Terrorismus betrachten; er lässt das Publikum aber an entscheidenden Stellen ziemlich ratlos zurück. Stellenweise liest sich der Text wie eine konkrete Anleitung zu organisierter Klima-Militanz – inklusive Social-Media-Strategie. Warum sich HANNIG dann auch noch so detailliert in Gewaltlust-Szenarien hineinsteigert, bleibt ihr Geheimnis.
An diesen Irritationen kann auch das persönliche Nachwort der Autorin nichts mehr ändern.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.

