“Der neue Gott” von Claudia PAGANINI
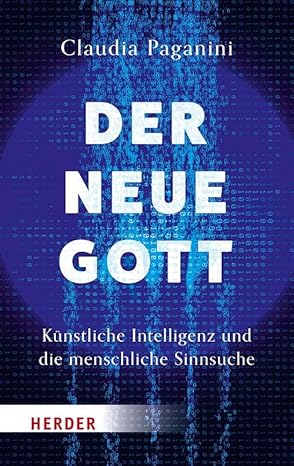
Eine spannende Fragestellung mitten im KI-Hype: Ist die Künstliche Intelligenz auf dem Weg, traditionelle Gottesbilder zu ersetzen? Steuern wir also zu Beginn des 3. Jahrtausend unserer Zeitrechnung auf eine neue Form der Göttlichkeit zu?
Dass die Autorin diese Frage ernst und wörtlich meint, lässt sich zunächst daran ablesen, dass sie Philosophin und Theologin ist. Für sie ist der Bezug zur Begrifflichkeit “Gott” also nicht nur eine publikumswirksame Metapher, sondern sehr konkret hinterlegt.
Noch deutlicher wird dann der theologische Bezug, wenn man in den Text einsteigt: PAGANINI liefert für den Rahmen ihrer Betrachtungen zur Rolle der KI nämlich nicht weniger als einen ziemlich detaillierten religionsgeschichtlichen Grundkurs. Sie führt die Leserschaft durch die kulturellen Stufen der Ausgestaltung von Göttlichkeit – beginnend bei ersten animistischen Naturgeistern bis hin zu den weltumgreifenden monotheistischen Gottesfiguren.
Die Autorin hat sich für die Untersuchung ihrer Hypothese eine Systematik ausgedacht, die einer Wissenschaftlerin zur Ehre gereicht: Sie hat sich die Grunddimensionen der alleinherrschenden Götter (in Christentum, Islam und Judentum) vorgenommen und diese einzeln mit den Eigenschaften verglichen, die man (angeblich) inzwischen den KI-Systemen zuschreibt.
PAGANINI schreibt also über “Allgegenwärtigkeit”, “Allwissenheit”, “Allmächtigkeit”, “Transzendenz”, “Nahbarkeit”, “Gerechtigkeit”, “Sinnstiftung” und “Fürsorglichkeit”.
Und sie tut das wiederum in einer bemerkenswerten Detailtiefe: Bevor sie diese Aspekte in der KI-Welt untersucht, greift sie noch einmal tief in die Theologie, um die Dimensionen dort zu unterfüttern.
Die von ihr herausgearbeiteten Schnittmengen zwischen alten Göttern und dem neuen KI-Gott sind durchaus nachvollziehbar und anregend.
Allerdings stimmt die Gewichtung nicht: Um sich schlaue Gedanken über die göttlichen Attribute der KI zu machen, ist es schlichtweg nicht notwendig, die jeweils betrachtete Dimension über die gesamte Religionsgeschichte zu verfolgen. An dieser Stelle bekommt man als Leser/in eher den Eindruck, dass die Autorin einfach aus der Tiefe ihres Fundus schöpfen will. Der Fragestellung des Buches hingegen nützt es eher wenig.
Ganz überzeugend ist der Ansatz von PAGANINI trotz aller Detailkenntnis und Systematik letztlich nicht. Göttlichkeit lässt sich als Summe der zugeschriebenen Attribute – also durch die hier angewandte Schablone – nicht allumfassend definieren. Vor allem wird von gläubigen Menschen Göttlichkeit mit einer emotionalen Gesamtbedeutung unterlegt, die sich nicht aus Einzelbausteinen zusammensetzen lässt. Auch der Aspekt der “letzten Erklärung” für die Erschaffung des Universums lässt sich in das KI-Modell kaum integrieren. So bleibt die spannende Frage nach dem “neuen Gott KI” letztlich doch zu einem guten Teil unbeantwortet.
Eine spannender Alternativansatz wird übrigens von dem Historiker und Bestseller-Autor HARARI vertreten: Für ihn beinhaltet die Übernahme der Sprachfähigkeit durch die aktuellen KI-Modelle letztlich auch das Potential, völlig neue Religions-Narrative zu generieren. Die so geschaffene neue Göttlichkeit würde dann nicht auf den Funktionen der KI selbst beruhen, sondern auf die Ausgestaltung neuer Glaubens-Systeme, die perfekt auf die Bedürfnisse einzelner Menschengruppen zugeschnitten sein könnten.
Es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, welche Perspektive mehr prognostische Kraft einfaltet.
Das Buch von PAGANINI ist vor allem für die Leserschaft eine Empfehlung, die bei der Reflexion über den Charakter, die Möglichkeiten und Risiken der KI gerne noch einen ausführlichen theologischen Nachhilfeunterricht mitnehmen.
Für die Meinungsbildung über das Gesamtphänomen KI liefert PAGANINI ganz sicher einen lesenswerten Beitrag.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.
“Die Macht der Musik” von Ullrich Fichtner
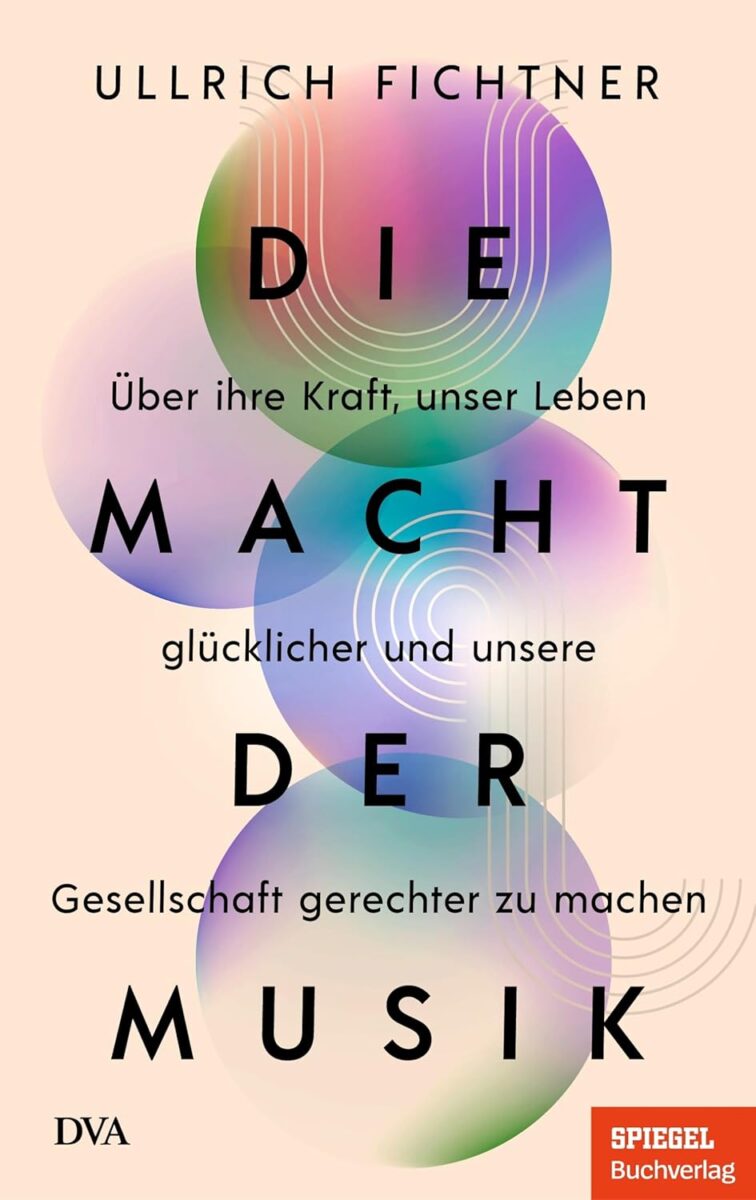
Es gibt sie, die Themen, die unangefochten im Mittelpunkt des aktuellen gesellschaftlichen Interesses stehen: Zu nennen wären da im Moment (Anfang 2026) die geopolitischen Veränderungen und Bedrohungen, die Frage der militärischen Macht, das Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen, die wirtschaftlichen Herausforderungen und die Sicherung unserer Sozialsysteme. Dazu kommt das Mega-Thema “KI”, das unaufhaltsam in alle Lebensbereiche einsickert.
Ist das die Zeit, ein Buch über Musik zu schreiben und zu lesen?
Der bekannte SPIEGEL-Journalist Ullrich FICHTNER hat diese Fragen für sich – und seine potentiellen Leserschaft – mit “ja” beantwortet.
In einem Satz könnte man es so sagen: Die Breite und der Tiefgang dieser sprachgewaltigen Reise durch das schier grenzenlose Universum der Musik vermittelt ein bemerkenswertes Leseerlebnis, das wohl kaum einen Musikfan unberührt und unbefriedigt zurücklassen wird.
Tatsächlich ist es die unglaubliche Vielfalt der betrachteten musikalischen Facetten, die einem als erstes den Atem verschlägt. Angesichts seiner eigenen – meist eher begrenzten – geschmacklichen Schwerpunktsetzungen, erscheinen die Offenheit, die Zugangswege und das Detailwissen des Autors fast übermenschlich. Man fragt sich ernsthaft: “Kann ein einzelner Mensch das alles auf sich vereinen? Kann man gleichzeitig Freund von und Experte für so viele – offensichtlich unvereinbare – Musikstile, Genres, Traditionen sein?
FICHTERs Antwort könnte diese Gegenfrage sein: “Wieso ‘unvereinbar’?
Wenn es eine zentrale Botschaft in diesem Buch gibt, dann folgende: Es gibt nur das eine große Menschheits-Phänomen ‘Musik’, das zentral und unwiederbringlich in Biologie und Kultur des Menschen eingebrannt ist.
Vor diesem Hintergrund gibt es für FICHTNER keine ‘gute’ und keine ‘schlechte’, keine ‘niveauvolle’ oder ‘banale’ Musik. Im Zentrum seiner Aufmerksamkeit steht, was Musik mit dem Menschen macht, was sie für ihn bedeutet, welchen Funktionen sie dienen kann.
Der Autor weiß ohne Zweifel viel über Musiktheorie, über die Kulturgeschichte der Musik, über die wirtschaftlichen Verwertungsmechanismen. Er teilt dieses Wissen auch mit uns.
Aber seine zentrale Botschaft ist eine andere: Er will erreichen, dass wir diesem ‘Schatz’ die Aufmerksamkeit schenken, die ihm zukommt.
Zwar tun wir das auf bestimmten Ebenen: So ist Musikberieselung überall präsent, die wirtschaftliche Bedeutung ist in Zeiten, wo Tourneen der Weltstars erstmals Milliarden einspielen, unübersehbar.
Gleichzeitig aber – so redet FICHTNER uns immer wieder ins Gewissen – vernachlässigen wir aufs Sträflichste die Möglichkeiten, die der verstärkte Einsatz der Musik in den Bereichen Erziehung, Bildung, Psychohygiene, Gesundheitsprophylaxe, Therapie, Resozialisierung und Rehabilitation spielen könnte. So hält er es beispielsweise für skandalös, dass ausgerechnet in Zeiten des digitalen Overflows ein beträchtlicher Teil der schulischen Musikbildung schlicht dauerhaft ausfällt.
Natürlich belegt FICHTNER seine Thesen in diesem Bereich mit entsprechenden Untersuchungen bzw. Befunden.
Über so etwas extrem Sinnliches wie Musik zu schreiben, ist schon prinzipiell eine Herausforderung. FICHTNER ist auf diesem Gebiet wahrlich ein Virtuose! Dass er es schafft, die passenden Worte für extrem unterschiedliche Musikrichtungen zu finden, ist wirklich bewundernswert.
Der Autor lässt wohl keinen Musikliebhaber mit seinen Vorlieben am Wegrand stehen: So sitzt der Wagnerianer mit dem Deep Purple-Fan in einem Boot, und zusammen steuern sie zuerst zum Klassik-Festival und dann zum Welt-Musik-Treffen. Zwischendurch gehen sie alle zusammen ins Kino und erfreuen sich an der Disney-Gassenhauern für die ganze Familie.
Sehr gut funktioniert auch seine Idee, sich durch die Leserschaft zu verschiedenen typischen Schauplätzen von Musikveranstaltungen begleiten zu lassen. So reist man mit FICHTNER rund um die Welt: zum Jazz-Festival nach Montreux, in die elitäre Klassikwelt ins Schloss Elmau, zum ewig jungen Gitarrenlehrer der Nation nach Duisburg, zum Mahler-Festival nach Amsterdam.
Einer ist offenbar überall zu Hause: Ullrich FICHTNER – und seine Liebe zur Musik!
Um dieses Buch in vollem Umfang zu genießen, sollte man wohl zwei Voraussetzungen mitbringen: Irgendeine musikalische Leidenschaft (egal welche) und die Bereitschaft, sich auf ganze andere musikalische Welten zumindest für eine Kapitellänge einmal einzulassen.
Zugegebener Weise ist letzteres nicht immer ganz einfach: FICHTNERs sprachliche Kürübungen sind zwar ohne Zweifel beeindruckend; aber in dieser Detailtiefe seitenlang über musikalische Facetten informiert zu werden, die völlig außerhalb des eigenen Spektrums liegen, ist auch eine Herausforderung. Da darf man vielleicht ein paar Abschnitte auch mal überfliegen…
Haben Sie schon länger nicht über Musik nachgedacht, obwohl sie doch eigentlich Musik lieben? Dann könnten sie sich den Gefallen tun und dieses Buch lesen!
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.
“Little Addictions” von Catherine GRAY
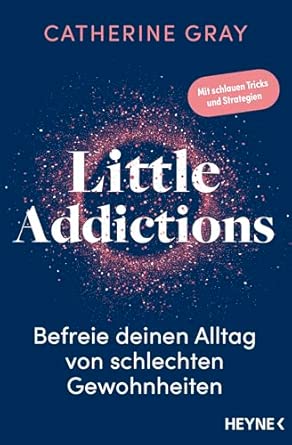
Die Szene der Selbsthilfeliteratur hat sich in den letzten 10-20 Jahren gewandelt:
Früher konnte man davon ausgehen , dass es in Bezug auf wissenschaftliche Seriosität einen deutlichen Unterschied zwischen einem etablierten journalistischen Zugang und einer Betroffenen-Sichtweise gab. Inzwischen löst sich dieser Unterschied immer häufiger in Luft auf.
Dieses Buch von Catherine GRAY ist ein überzeugendes Beispiel dafür.
GRAY ist im Bereich kleinen und großen Süchte ganz eindeutig eine Betroffene. Sie macht nicht nur keinen Hehl daraus, sondern sie benutzt dieses Insider-Wissen als Roten Faden bei ihrer Reise durch die “Kleinen Abhängigkeiten (die im Untertitel dann noch als “schlechte Angewohnheiten” verniedlicht werden).
Sie spricht nicht nur sehr eindeutig von Ihrer (überwundenen) Alkohol-Sucht, sondern macht ihre (unterschiedlichen) Erfahrungen und Gefährdungsniveaus für alle besprochenen Bereiche zum Thema. Das Spektrum ist breit gefächert und deckt sowohl stoffgebundene (Alkohol, Nikotin, Koffein, Cannabis, hochverarbeitete Lebensmittel), als auch verhaltensbezogene problematische “Gewohnheiten” ab (Glücksspiel, Medien, Pornogafie, Beziehungen/Sex, Konsum, usw.).
Entscheidend für die Qualität und Wirkung des Buches ist jedoch die Kombination von Authentizität (“ich war/bin ein teil der Szene; ich weiß wie sich das anfühlt, ich bin alles andere als eine “Heilige”) und solider Fachkunde. Und so, wie GRAY auf der Erfahrungsebene aus dem Vollen schöpfen kann, hat sie auch im Bereich der fachlichen Vertiefung einiges zu bieten: Sie hat sich nicht nur in die psychologischen und neurophysiologischen Grundlagen eingelesen, sondern hat auch zahlreiche Gespräche mit Experten und Expertinnen geführt (u.a. in einer etablierten Entzugsklinik).
So erfahren wir eine Menge über die Arbeits- und Wirkungsweise unserer neuronalen Belohnungszentren, über sinnvolle Selbstkontroll-Strategien und therapeutische Methoden.
Für die Seriosität ihres Textes spricht auch die klare Unterscheidung zwischen “kleinen” und “großen” Abhängigkeiten. Sie gibt konkrete Hinweise, wann eine problematische Angewohnheit sich zu einem ernsthalten gesundheitlichen Risiko auswächst und professionelle Hilfe benötig.
Somit ist die Zielgruppe für diese informative und alltagsnahe Publikation klar zu umreißen: Es sind Menschen, denen ein rein sachbezogener Zugang zum Thema zu “trocken” wäre und die sich lieber von jemandem ansprechen und motivieren lassen, der den “alltäglichen Wahnsinn” mit all seinen Verlockungen und Versuchungen selbst durchlebt und durchlitten hat.
Hier, gegenüber Catherine GRAY, muss sich wirklich niemand seiner Schwächen schämen. Selbst wenn man schon viel Selbstachtung verloren haben sollte – die Autorin zeigt, dass man nicht alleine ist und – was noch wichtiger ist – dass man sich auch von ziemlich weit unten wieder hocharbeiten kann. Und GRAY vergisst auch nicht, auf die Mitverantwortung derjenigen hinzuweisen, die die entsprechenden “Suchtmittel” herstellen, bewerben und nicht regulieren bzw. extrem leicht zugänglich machen.
Wer allerdings nur die Sachinformation sucht, den werden all die persönlichen Erfahrungen und Bekenntnisse aus einem “bewegten” Leben vermutlich eher nerven.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.
“The Daily Feminist” von Evelyn Höllrigl TSCHAIKNER
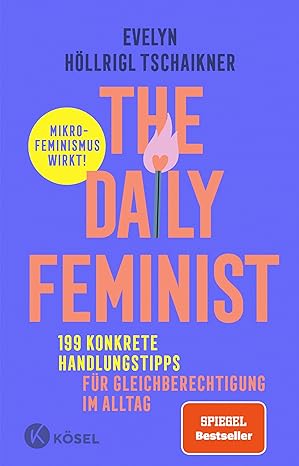
Über Feminismus lässt sich auf der theoretischen Ebene trefflich streiten; Konflikte über Ziele und Wege gibt es dabei auch innerhalb der Frauenrechts-Community.
Die Autorin (Journalistin und Social-Media-Bloggerin) geht in diesem Buch einen anderen Weg: Sie übersetzt Feminismus konsequent in kleinschrittiges Alltagsverhalten und stellt so eine konkrete Anleitung für verschiedenste Lebensbereiche zur Verfügung – immer mit dem Ziel, durch eine “passende” Aktion oder Äußerung einen feministischen Impuls zu setzen.
Bei insgesamt 199 Einzelvorschlägen kann man wohl davon ausgehen, dass keine wesentlichen Aspekte übersehen werden – und genauso ist es: Natürlich werden die gendergerechte Sprache und der alltägliche Sexismus genauso abgehandelt wie die Bereiche Familie, Berufsleben, Schönheitsideale, Gesundheit, Care-Arbeit, Sicherheit und Partnerschaft.
Die einzelnen Verhaltens-Hinweise werden von HÖLLRIGL TSCHAIKNER in den jeweiligen Kontext eingebettet. Insofern geht es hier nicht um eine Publikation ohne theoretische Einbettung; entsprechende Literaturbezüge geben dem Text einen sozialwissenschaftlichen Anstrich.
Es bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung, dass hier kein neutrales Sachbuch vorgelegt wird, das sich an die Mainstream-Öffentlichkeit richtet. Alles ist klar definiert und wird auch erwartungsgemäß umgesetzt: Die Zielgruppe wird in der “korrekten” Sprache adressiert, der feministische Blick auf die Einschränkungen, Benachteiligungen und Diskriminierungen des weiblichen Geschlechts (bzw. queerer Menschen) durch die patriarchalen Strukturen wird vorausgesetzt. Es geht um Bestätigung, Erweiterung und Vertiefung gemeinsamer Grunderfahrungen und Überzeugungen, nicht um das Gewinnen neuer Mitstreiter/innen.
Der entscheidende “Mehrwert” dieses Textes liegt wohl in der (in Teilbereichen) kreativen und originellen Ausgestaltung der 199 Verhaltensvorschläge. Die Autorin hat sich insgesamt recht überzeugend darum bemüht, ihre kleinen (und etwas größeren) provokanten “Nadelstiche” immer mal wieder auch ironisch-humoristisch zu verpacken und die Kraft der Überraschung zu nutzen: So schlägt sie z.B. vor, Männern bei Tragen schwerer Gepäckstücke zu helfen oder konsequent von “Männerfußball” zu reden, solange der Begriff “Frauenfußball” existiert.
HÖLLRIGL TSCHAIKNER setzt im Alltagskampf verstärkt auf feministische Solidarität und ruft dazu auf, jede Gelegenheit im privaten und öffentlichen Raum zu nutzen, um den Kampf um die Sichtbarkeit und Geltungsumfang von Frauenrechten weiterzuführen.
Dem Konzept des Buches entspricht dann auch der Umstand, dass mögliche alternative bzw. kontroverse Sichtweisen auf Grundannahmen (z.B. eine Relativierung des Ausbeutungs-Charakters der privaten Care-Arbeit oder eine stärker an biologischen Gegebenheiten orientierter Blick auf Geschlechtsunterschiede) zwar gelegentlich kurz benannt werden, dann aber mit einem entschlossenen “Federstrich” zur Seite geschoben werden. Es gibt in diesem Buch keinen ernsthaften argumentativen Austausch mit Feminismus-skeptischen Positionen.
Das ist keineswegs ein Makel – denn dieser Anspruch wird auch gar nicht erhoben. Man sollte es nur wissen.
Natürlich sind 199 Beispiele eine Menge. Die pure Masse der Aspekte könnte – zumindest eine etwas distanziertere Leserschaft – in einen Feminismus-Overload versetzen, vielleicht sogar stellenweise eine Abwehrreaktion hervorrufen. Dies ließe sich vermutlich durch einen dosierten Konsum des Buches kontrollieren.
Die meisten potentiellen Leser/innen dieses Textes bringen wohl auch die notwendige Bereitschaft und Toleranz auf, sich dem – wohl unvermeidlichen – subkulturellen Sprachcode zu stellen: So werden immer mal wieder Menschen als weiblich “gelesen” und manchmal geht es auch um “Menschen mit Uterus”. Wenn’s hilft…
Insgesamt bietet diese Schrift mit “Handbuchcharakter” einen breit aufgestellten Überblick über Anlässe und Gewohnheiten, die in unserem gesellschaftlichen Alltag noch auf einen weitergehenden Abbau patriarchaler Strukturen warten. Der Zugang wird durch eine geschickte Mischung von feministischer Basistheorie und weit heruntergebrochenem Alltagsbezug erleichtert.
Zwar wird auch über notwendige “Wut” auf bestimmte Verhältnisse gesprochen; viele Leser/innen werden aber die Anregungen auch mit einem belustigten Lächeln zur Kenntnis nehmen.
Zusammenfassend lässt sich wohl festhalten, dass die Autorin Ihre Zielgruppe bestens bedient; für andere bietet es zumindest eine große Anzahl von Denkanstößen. Dass dabei nicht gerade eine feine Ausdifferenzierung von kontroversen Perspektiven erfolgt oder die Bereitschaft zum Aushalten von theoretischen bzw. gesellschaftlichen Widersprüchen gefördert wird, ist sicherlich einkalkuliert.
Vermisst werden könnte es trotzdem.
(Nachbemerkung: Diese Rezension wurde von einem alten weißen Cis-Mann verfasst. Sie hat daher möglicherweise für die eigentliche Zielgruppe dieses Buches aus prinzipiellen Gründen kaum Relevanz. Vielleicht hat sie aber für interessierte Beobachter oder Sympathisanten der feministischen Bewegung doch einen gewissen Informationswert.)
Der Bezug zu meinem Web-Projekt “WELTVERSTEHEN”:
Die größte Nähe besteht zu der Themenseite “Feminismus“. Hier finden Sie die Einbettung in einen größeren Zusammenhang und weitere inhaltliche Hinweise bzw. Anregungen.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.
“Die Stunde des Herzens” von Irvin D. YALOM (mit B. Yalom)
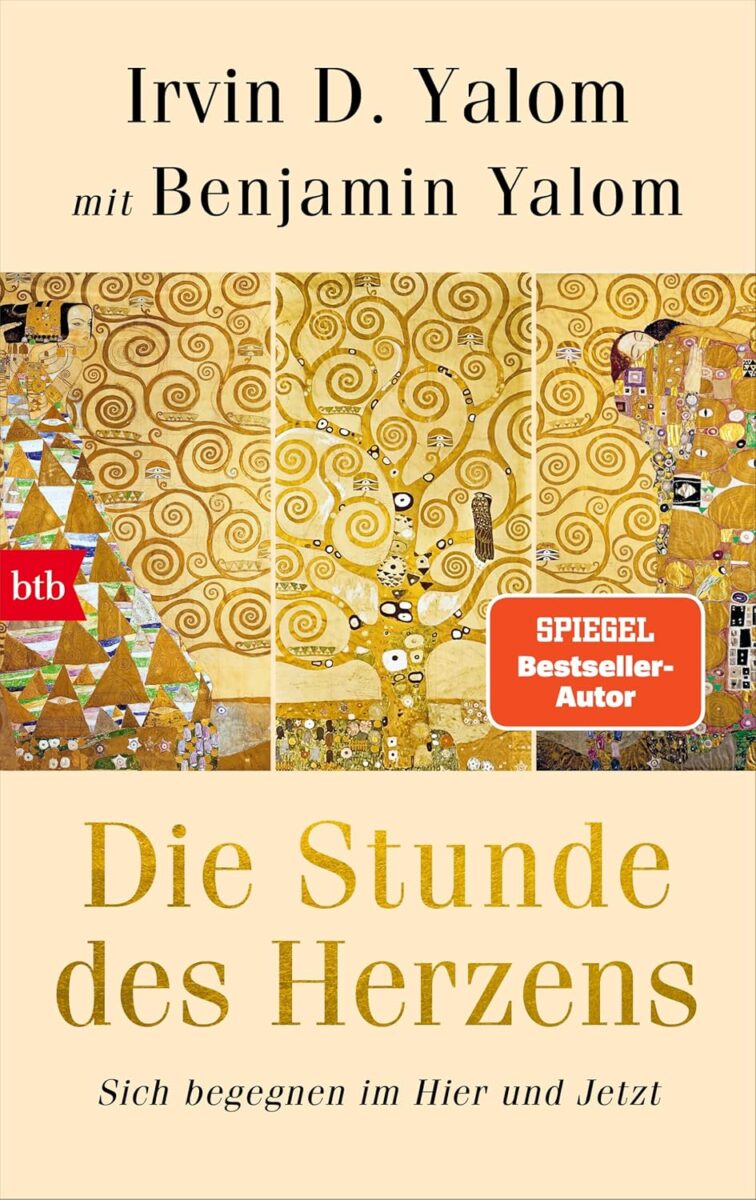
Um diesem Buch, dem “Alterswerk” eines international bekannten Psychotherapeuten und Schriftstellers, gerecht zu werden könnte man eigentlich zwei ganz verschiedene Rezensionen schreiben. Ich versuche es mal mit zwei unterschiedlichen Perspektiven innerhalb einer Besprechung.
Setzen wir mal die Informationsbasis an einen (gemeinsamen) Anfang:
Irving D. YALOM hat jahrzehntelang mit großem Erfolg und begleitet durch viel öffentliche Anerkennung im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie gearbeitet. Einen besonderen fachlichen Namen hat er sich durch die Ausarbeitung der sog. “Existenziellen Psychotherapie” und im Bereich Gruppentherapie erworben. Er hatte als Dozent, Ausbilder und Fachbuchautor prägende Einflüsse auf eine ganze Psychotherapeuten-Generation.
Zu seinem öffentlichen Bekanntheitsgrad, in der er fast so etwas wie einen “Guru-Status” zugeschrieben bekam bzw. bekommt, trugen vor allem seine weltweit erfolgreichen, stark literarisch orientierten “Sach-Romane” bei, in denen er Aspekte aus Psychologie bzw. Philosophie und eigene therapeutische Erfahrungen zu einem für ein breites Publikum attraktives Gesamtkunstwerk verwob.
Ein Dokumentarfilm über sein Leben und eigene biografisch orientierte Publikationen (zuletzt “Unzertrennlich“) trugen dazu bei, dass auch die Person YALOM im Blickpunkt blieb.
In dem hier besprochenen Buch schildert der Autor die letzte Phase seines psychotherapeutischen Schaffens: Angesichts seines nachlassenden Erinnerungsvermögens hatte YALOM sich entschlossen, nur noch einmalige (und einstündige) “Konsultationen” anzubieten. Da die meisten dieser Gespräche während der Corona-Pandemie stattfanden, handelt sich (fast ausnahmslos) um Video-Sitzungen.
Die Gliederung des Buches ergibt sich aus den 14 “Fallgeschichten”, in denen der Autor zwischen konkreten Verlaufsschilderungen, der Darstellung seiner begleitenden Gedanken bzw. Gefühle und der fachlich-theoretischen Einordnung seines therapeutischen Ansatzes wechselt. Auch seine persönliche Lebenssituation, die stark durch die Auswirkungen des Todes seiner Frau geprägt wird, ist immer wieder Thema.
Strukturell betrachtet handelt es sich am ehesten um Erst- bzw. Klärungsgespräche, in denen der Anlass zur Kontaktaufnahme, die Motivation bzw. Zielsetzung der “Patienten” und eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen (durchweg in Richtung “längerfristige Psychotherapie”) zum Thema werden. In den meisten Fällen erfährt die Leserschaft auch etwas über die unmittelbaren Reaktionen auf den Konsultationstermin (meist in Form eines kurzen Email-Austausches).
Methodisch konzentriert sich YALOM auf den Aufbau einer möglichst “intimen” therapeutischen Beziehung, innerhalb derer die Gesprächspartner ihre Blockaden und Vermeidungsstrategien überwinden und zu ihren “eigentlichen” (meist existenziellen) Problemstellungen finden. Um den Prozess zu beschleunigen bietet YALOM an, sich selbst auf eine sehr private bzw. persönliche Art einzubringen: Er lädt die Patienten ein, ihm entsprechende Fragen zu stellen. Der Ankerpunkt für de Gesprächsführung ist immer wieder die Fokussierung auf das unmittelbare Geschehen und Empfinden im “Hier und Jetzt”.
Die positive Perspektive:
Dem Autor gelingt es auch in diesem Buch (es ist wohl das 26.), seinen besonderen Zugang zur Psychotherapie auf eine lebendige und menschlich-sympathische Art zu vermitteln. Obwohl er altersbedingt seinen gewohnten (langfristig ausgerichteten) Therapieansatz aufgibt und unter den Einschränkungen seiner Gedächtnisfunktionen sichtbar leidet, treibt ihn weiter seine Mission an: deutlich zu machen, dass es in der psychotherapeutischen Arbeit in erster Linie um eine vertrauensvolle bzw. authentische Beziehung und (meist) um existentielle Grundfragen geht.
Die treue Leserschaft, die den Autor schon länger (teilweise seit Jahrzehnten) voller Bewunderung begleitet, wird sich sicher gerne anrühren lassen von den “weisen” (gelegentlich auch mit Selbstironie angereicherten) Reflexionen einer in Ehren gealterten “Grauen Eminenz” seines Faches.
Die kritische Perspektive:
Eine Bemerkung vorweg: Nicht in der gesamten Fachöffentlichkeit genießt YALOM einen so herausgehobenen Status, wie sich das in seiner öffentlichen Fangemeinde abbildet. Seine Beträge zur Entwicklung der Psychotherapie als wissenschaftlich begründete Disziplin sind aus akademischer Perspektive nicht unbedingt spektakulär.
So wirkt es z.B. auch in dem aktuellen Buch ein wenig übertrieben und selbstverliebt, wie sehr sich der Autor die Erkenntnis “die Beziehung heilt” auf die eigenen Fahnen schreibt.
Interessanterweise nennt YALOM an keiner Stelle die Überschneidung mit dem gesprächstherapeutischen Ansatz von ROGERS (obwohl er fast identische Begrifflichkeiten benutzt).
Schaut man sich die dargestellten “Konsultationen” genauer an, findet man eine Mischung zwischen (ganz normaler) fachlicher Abklärung der Ausgangslage und einer intensiven, aber doch sehr begrenzten Gesprächssituation, die in eine “echte” Therapieempfehlung mündet. Diese sollte – nach der Überzeugung des Autors – natürlich immer “langfristig” sein; kürzeren und eher methodisch ausgerichteten Therapieformen steht er sehr skeptisch gegenüber.
Wäre es nicht der berühmte – und so offensichtlich mit seinen kognitiven Grenzen kämpfende – Guru, würde man von den beschriebenen Abläufen nicht unbedingt große “Wunder” erwarten.
Blickt man auf die Leidenschaft, mit der YALOM sein “persönliches Einbringen” in den therapeutischen Prozess beschreibt, könnte sich die (ketzerische) Frage stellen, wem dieses Vorgehen wohl am meisten nützt. Ganz offensichtlich ist dieser sehr alte Mann einfach auch sehr mit sich beschäftigt: mit der Trauer um seine Frau, mit den verbleibenden Lebensperspektiven, mit dem anstehenden Verlust seines Identitätskerns als “ewiger Therapeut”. Er genießt es ganz unzweifelhaft, sich selbst immer wieder zum Thema zu machen.
Das ist alles verständlich, ehrenvoll und absolut menschlich. Aber rechtfertigt es, für diese (sehr netten und für beiden Seiten gewinnbringenden einstündigen Begegnungen) jeweils 400 $ einzustreichen? Und daraus noch ein letztes Buch zu machen (in dem inhaltlich ganz sicher nichts Neues steht)? Wäre es nicht am Ende einer verdienstvollen Karriere und eines erfüllenden Lebensweges auch eine letzte Aufgabe gewesen, rechtzeitig loszulassen – auch als Modell für andere?
An dieser Stelle kommt sein Sohn ins Spiel, der ja als Mit-Autor genannt wird.
Benjamin YALOM ist erst spät in die (großen) Fußstapfen seines Vaters getreten – gerade rechtzeitig und en Staffelstab zu übernehmen. In dem Schlusskapitel gibt er eine Meta-Perspektive, fasst nochmal die therapeutischen und persönlichen Essentials zusammen.
Man erfährt nicht, wieviel er dazu beitragen musste, dass dieses Buch noch in dieser Form zustande kommen konnte. Es wäre interessant zu erfahren, ob es bei ihm auch ambivalente Gefühle gegenüber diesem Projektes gab.
Und mein Resümee:
Wenn einem die Person YALOM literarisch, fachlich oder emotional etwas bedeutet, sollte man dieses Buch nicht auslassen. Es ist menschlich anrührend und so etwas wie ein Vermächtnis.
Andere potentielle Interessenten mit Vorinformationen sollten sich vielleicht fragen, ob sie wirklich “mehr desselben” möchten bzw. brauchen.
Sollte man als YALOM-Einsteiger auf dieses Buch stoßen: Warum nicht? Es könnte als eine leicht zu lesende Einführung in die Welt eines bekannten Therapeuten dienen. Natürlich sollte man nicht erwarten, dass man DIE Psychotherapie kennenlernt. Vielleicht ist man danach motiviert, einen seiner Romane zu lesen…
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.
“Happy Hirn” von Dr. Ben REIN
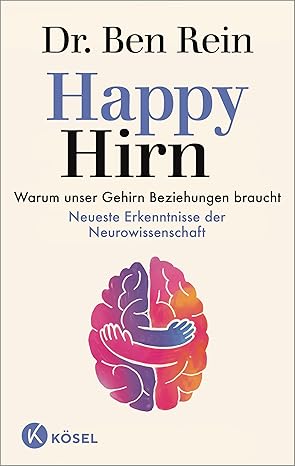
Gelegentlich trifft man auf Bücher, deren Titel so hohe Erwartungen wecken, dass man letztlich von einer Mogelpackung sprechen könnte. Hier liegt der umgekehrte Fall vor: Das platt und dümmlich wirkende “Happy Hirn” wird dem Charakter und Niveau des Buches nicht ansatzweise gerecht; der ergänzende Untertitel dann schon eher.
Wir haben es mit einem Sachbuch zu tun, dass zwar aus einer persönlichen Perspektive geschrieben wurde, aber von der Informationstiefe her eindeutig als wissenschaftlich fundiert betrachtet werden kann.
Der Autor, ein in Stanford ausgebildeter Neurowissenschaftlicher, betrachtet sozusagen die Beziehungsseite unseres Gehirns. Er zeigt uns, wie soziale Bedürfnisse, Gefühle und Verhaltensweisen auf neurologischer Ebene repräsentiert sind. Insbesondere will er vermitteln, wie eng die Ausgestaltung unserer Beziehungen mit grundlegenden Erfahrungen von Zufriedenheit und Glück zusammenhängt.
Dahinter steckt mehr als ein didaktisch kompetent umgesetzter Aufklärungswunsch: Dr. REIN geht mit dieser Schrift der persönlichen Mission nach, seine Leserschaft von der zentralen Bedeutung möglichst vieler und intensiver Sozialbeziehungen für die eigene Hirngesundheit zu überzeugen. Statt “Hirngesundheit” könnt man auch “Lebensqualität”, “Lebensglück” oder “psychisches und physisches Wohlbefinden” sagen.
REINs Ziel ist es eindeutig, sachkundige Information niederschwellig an ein interessiertes Publikum zu transportieren. Das gelingt ihm in weiten Strecken des Buches gut: Er ist didaktisch gut aufgestellt, bringt sich und seine Biografie ein, spricht seine Leserschaft direkt an und bietet alltagsbezogene Anregungen und Übungen.
Das ist alles lobenswert.
Gelegentlich übertreibt er es mit dem persönlichen Bezug allerdings ein wenig: So spiegelt die überraschend große Gewichtung des Themas “Psychoaktive Drogen” eher REINs eigenen Arbeitsschwerpunkt wider als die objektive Bedeutung dieses Aspekts für das Thema des Buches.
Noch ein wenig doller treibt es der Autor im Kapitel über segensreiche Rolle von Haustieren für die Hirngesundheit: Hier treibt ihn seine private Tierliebe zu einem Enthusiasmus, der nicht so recht zu einem seriösen Sachbuch passt.
Unterm Strich bietet “Happy Hirn” nicht nur einen gut lesbaren und inhaltlich fundierten Anlass, sich über die den sozialen Charakter unseres Gehirns gründlich zu informieren, sondern motiviert auch gleich eindringlich dazu, seine eigene Lebensführung in diese Richtung zu korrigieren.
Der Bezug zu meinem Web-Projekt “WELTVERSTEHEN”:
Die größte Nähe besteht zu der Themenseite “Neurowissenschaft“. Hier finden Sie die Einbettung in einen größeren Zusammenhang und weitere inhaltliche Hinweise bzw. Anregungen.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.
“Hoffnungslos optimistisch” von Dirk STEFFENS
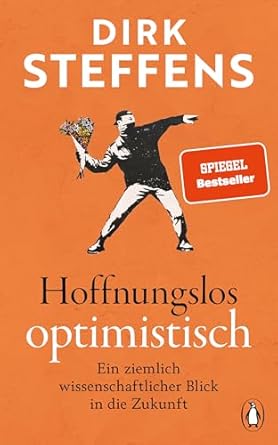
Dieses Buch ist nicht die erste Veröffentlichung des Autors im Themenbereich der Nachhaltigkeit. Auch hier gab es schon diesbezügliche Besprechungen (“Projekt Zukunft“, “ÜberLeben“).
Was ist neu? Was ist anders?
STEFFENS ist ein didaktisch begabter und routinierter Wissenschafts-Journalist. Genau das stellt er auch in seinem neuen Band unter Beweis. Man könnte auch sagen: Er ist ein recht geschickter “Menschen-Fänger”.
In diesem Buch wirft der Autor ein besonderes Netz aus: Es heißt “Optimismus”.
Der Vorteil: Dieses Netz wirkt hell und freundlich – eben nicht bedrohlich.
STEFFENS schafft es in diesem Buch, zwei vermeintlich unvereinbare Ziele miteinander zu verbinden: Er spricht expliziten Klartext bei der Beschreibung der planetaren Zustände und Risiken – und verbreitet gleichzeitig eine Stimmung von Aufbruch und Zuversicht.
Diese Doppelbotschaft drückt schon der Titel des Buches aus: “Eigentlich” befinden sich die meisten unserer planetaren Systeme in einem hoffnungslosen Zustand; und doch gibt es ganz viele Beispiele für Projekte, Initiativen und Innovationen, die dabei helfen könnten, das Ruder noch einmal herumzureißen (und so optimistisch stimmen könnten).
Die Strategie des Autors ist leicht zu erkennen: Er möchte die Lage ganz sicher nicht beschönigen, aber er möchte gegen Resignation und Zynismus anarbeiten. Seine Botschaft: “Engagement lohnt sich weiterhin! Schaut nur mal genauer hin, was alles schon passiert und funktioniert!”
Wenn man sich zum Thema Klima, Artensterben, Umweltzerstörung und Nachhaltigkeit bisher noch nicht näher informiert hat, lernt man in diesem locker und verständlich geschriebenen Sachbuch eine ganze Menge: Ohne dass man es als Leser/in so richtig merkt, streut der Autor einen ansehnlichen Batzen an Informationen in seinen gefälligen Text. Und tatsächlich ist fast nirgendwo ein erhobener Zeigefinger in Sicht! STEFFENS macht es auf die sanfte Tour: Er ist sozusagen der “Anti-Klimakleber”!
Trotzdem könnte der Text doch den einem oder die andere enttäuschen:
Wer in den letzten ca. 10 Jahren die Nachhaltigkeits-Diskussion halbwegs aufmerksam verfolgt hat, erfährt rein faktisch wenig Neues. Wenn man genau hinschaut, richtet sich das Buch an “Einsteiger” in diese Thematik; für diese Zielgruppe ist es allerdings exzellent geeignet!
Ein wenig irritierend mag der von STEFFENS verbreitete Optimismus für diejenigen sein, die sich in diesen – ziemlich verrückten und gefährlichen – Zeiten mit der Gesamt-Weltlage auseinandersetzen. So motivierend auch die technischen und politischen Teileerfolge im Bereich von Energiewende und Klima-/Umweltschutz sein mögen: So richtige Zuversicht könnte wohl nur aufkommen, wenn man alle anderen (geopolitischen, gesellschaftlichen und militärischen) Bedrohungen ausblendet. So ganz passt die Botschaft eben doch nicht in die Landschaft – zumal auch der Roll-Back in der Klimapolitik immer noch an Fahrt aufnimmt.
STEFFENS hat ein nützliches, informatives und sympathisches Buch geschrieben. Schenken Sie es jemandem, den Sie für das Thema Nachhaltigkeit interessieren und gewinnen möchten, ohne zu überfordern oder zu belehren. Es ist eine angenehme Lektüre, die Wissen und Haltung vermittelt.
Der Bezug zu meinem Web-Projekt “WELTVERSTEHEN”:
Die größte Nähe besteht zu der Themenseite “Klimazukunft“. Hier finden Sie die Einbettung in einen größeren Zusammenhang und weitere inhaltliche Hinweise bzw. Anregungen.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.
“Der Hase mit den Bernsteinaugen” von Edmund de WAAL
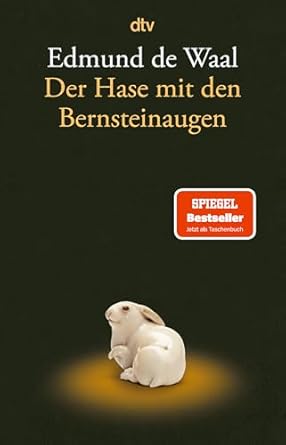
Dieses Buch fordert seine Leserschaft – es schenkt ihr aber auch eine Leseerlebnis von ungewöhnlicher Intensität.
Erzählt wird die (faktenorientierte) Geschichte einer wohlhabenden jüdischen Kaufmanns- und Bankiersfamilie (Ephrussi), deren Mitglieder – und damit auch deren wirtschaftlichen und kulturellen Einfluss – sich über die Stationen Odessa, Paris, Wien und Tokio ausbreiteten und damit auch ein Spiegelbild bedeutsamer geschichtlicher Epochen und Ereignisse der letzten ca. 150 Jahre wurden.
Die Perspektive, die dabei eingenommen wird, speist sich aus zwei Quellen:
Zunächst durch den Autor und Ich-Erzähler, der dem dokumentarischen Roman dadurch eine autobiografische Note gibt, dass er selbst als Nachkomme der Ephrussi-Dynastie die Familien-Recherche durchführt.
Zum anderen – und da kommen wir auf den Buchtitel – stehen im Mittelpunkt des Erzählfadens eine Sammlung japanischer Miniatur-Schnitzereien (sog. “Netsuke”): Ihr Weg durch die zeitlichen und geografischen Räume eröffnet detailreiche Blicke auf Lebensverhältnisse, Karrieren, Epochen und Katastrophen.
Im ersten Teil des Buches werden wir Zeuge des spektakulären wirtschaftlichen Aufstiegs der Brüder Charles (in Paris) und Ignaz (in Wien).
Der Autor zeichnet nicht nur den – scheinbar unaufhaltsam – wachsenden Wohlstand der Familien, sondern schildert vor allem in diesem Kontext aufblühende großbürgerliche (fast feudale) Lebensart, die sich insbesondere durch die Integration in die “besseren Kreise” und die Sammlung, und Zurschaustellung von Kunstgegenständen aller Art manifestiert.
Der Blick hinter dies Kulissen dieser wirtschaftlichen und kulturellen Oberschicht wird in einer solch geschärften Intensität geworfen, dass hinter jeder zweiten Ecke durch den Schleier der Kultiviertheit eine Ahnung von der fast perversen Übersteigerung dieser Luxuswelt durchscheint.
Diese Gradwanderung zwischen einer Faszination durch die Leidenschaft und Expertise der Kunstliebhaber und dem Bewusstsein hinsichtlich ihrer ungeheuren materiellen Privilegien zieht sich über weite Strecken des Buches. Dabei trägt auch der Autor selbst zu diesem labilen Gleichgewicht bei: Während er gegenüber dem früheren Lebensstil der Ephrussis (und deren Umfeld) durchaus eine innere Distanz zeigt, steht er als Künstler und Kunstexperte mit großer Anteilnahme in der Tradition der internationalen Kulturgeschichte der letzten Jahrhunderte.
Allein die Beschreibung der Herstellung und Eigenschaften der japanischen Miniaturen – um deren Schicksal es ja in dem Buch gehen soll – zeugt von einer Begeisterung und einer geradezu überwältigendem Differenziertheit in der Wahrnehmung und im Sprachausdruck.
Die entscheidende Dynamik des Buches entfaltet sich mit der Machtergreifung der Nazis in Wien: War man bis dahin hin- und hergerissen zwischen Respekt und Befremden gegenüber der in Reichtum schwelgenden Elite, klärt der Kultur- und Zivilisationsbruch die Bewertungen in einer radikalen Eindeutigkeit: Hier werden nicht nur Kunstwerke geraubt und ein gewachsener Lebensstil – im wörtlichsten Sinne – zertrümmert; hier nimmt sich eine barbarische Menschenverachtung Raum, die im denkbar schärfsten Kontrast zu jeder Form der Kultiviertheit steht.
De WAAL schafft durch seine Rahmenhandlung immer wieder eine Distanz zum eigentlichen Geschehen. Er beschreibt auch sein Recherchieren und Dokumentieren, seine Besuche an Originalschauplätzen, Museen und Archiven. Auch das Kunstschaffen selbst bekommt seinen Platz: Die Leser bekommen insbesondere vertiefte Einblicke in eine Epoche des japanischen Kunsthandwerks, aber auch in die Arbeit des Autors an der Töpferscheibe.
Das Einlassen auf diesen Roman kann insgesamt nur gelingen, wenn man bereit ist, sich in einer herausfordernden Intensität und Detailtiefe in die Welt der “schönen Dinge” mitnehmen zu lassen. Zwar werden auch Personen und ihr privates und gesellschaftliches Miteinander beschrieben; all das steht aber in einem permanenten Kontext mit den umgebenden kulturellen Erzeugnissen. Diese sind zwar auch – aber nie nur – Statussymbole und Aushängeschild für die Erlesenheit des eigenen Geschmacks. Sie führen sozusagen ein eigenes Leben…
Dieser sehr besondere Einblick in eine vergangene Epoche ist ohne die besondere Konstellation der Autorenschaft nicht denkbar: Nur die doppelte Beteiligung als Teil der Familiengeschichte und als Kunstschaffender bzw. Kunstexperte konnte dieses Sprachkunstwerk hervorbringen.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.
“Hillbilly-Elegie” von J.D. VANCE
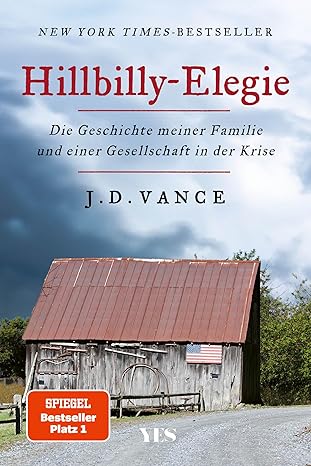
Wir schreiben das Jahr 2026 und das Erscheinen dieses Buches liegt somit genau 10 Jahre zurück. Der Autor dieses Familien-Biografie ist inzwischen Vizepräsident der USA und einer der ideologisch gefestigtsten Vertreter der aktuellen US-Politik. Viele Beobachter halten VANCE für langfristig einflussreicher als den erratischen und pathologisch-narzisstischen Trump.
Unabhängig von der (literarischen) Qualität dieses Buches erscheint es daher sinnvoll und lohnend, sich mit der Vergangenheit und dem Weltbild dieses Menschen auseinanderzusetzen. Es passiert wohl nicht sehr häufig, dass ein so machtvoller Politiker einen so intimen Einblick in seine persönliche Geschichte freilegt – geschrieben nicht nach, sondern deutlich vor seinem Karriere-Gipfel.
Was läge also näher als der Versuch, aus dem Lebensweg, vor allem aber aus der Bewertung der eigenen Biografie, Hinweise für die Potentiale und Risiken dieses Politikers zu suchen?
In beeindruckender Klarheit und Direktheit schildert VANCE eine Kindheit und Jugend, die es nach halbwegs zeitgemäßen pädagogischen Maßstäben – zumindest in Deutschland – so in den letzten Jahrzehnten gar nicht hätte geben dürfen. Jedes denkbare Jugendamt hätte früher oder später in diese absolut desolaten Familienverhältnisse eingegriffen und die Kinder einer anderen (privaten oder öffentlichen) Betreuung zugeführt. Das Besondere an den vom Autor geschilderten Verhältnisse ist dabei, dass VANCE seine Erfahrungen nicht als tragisches Einzelschicksal beschreibt, sondern als typisch bzw. exemplarisch für eine breite gesellschaftliche Entwicklung, die durch wirtschaftlichen Wandel hervorgerufen wurde.
Hintergrund ist eine langfristige Struktur-Krise der amerikanischen Kohle- und Stahlindustrie in dem ländlich geprägter, strukturschwacher Teil der Appalachen (u. a. Ost-Kentucky/West Virginia) samt dem angrenzenden Rust-Belt-Gürtel im Mittleren Westen (z.B. in Ohio). Diese Region ist geprägt von Abwanderung und dem Niedergang klassischer Industrie- und Bergbaujobs. Das Ergebnis waren prekäre Erwerbsbiografien und eine zerbrechende Alltagsstabilität: Wohnen, Familie, Bildung, Zukunftsplanung – und damit die soziale Selbststeuerung der Gemeinden. In dem Umfeld von sinkender Kaufkraft und wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit wuchsen soziale, familiäre und individuelle Belastungen und Konflikte wie Sucht, Depression und Kriminalität.
Auch wenn man nicht alle psychischen Auffälligkeiten der Menschen, unter denen VANCE aufgewachsen sind, unmittelbar mit diesen Faktoren in Verbindung bringen kann, bilden diese die Basis für die individuellen Schicksale.
Während VANCE sich zunächst sehr viel Zeit nimmt, den Ablauf seiner familiären Odyssee in allen Verästelungen zu beschreiben, versucht er im zweiten (kürzeren) Teil des Buches seinen persönlichen Ausweg bzw. Aufstieg nachvollziehbar zu machen. Hier spielen – neben der einen zuverlässigen Bindungsperson (Großmutter) – zwei Faktoren eine Hauptrolle: Die Armee als korrigierende “pädagogische” Kraft, die Defizite der familiären Sozialisation auszugleichen vermag (Struktur, Härte und Disziplin), und die prägenden Einflüsse einer akademischen Eliteausbildung, die vormals verschlossene Türen öffnen kann.
Wie wird nun ein Mensch mit diesem biografischen Hintergrund ein strammer Trump-Anhänger mit einem durch und durch konservativen und individualistischen Menschenbild?
Schon in “Hillbilly-Elegie” wird deutlich, dass der Autor zwar die erschwerenden und belastenden (wirtschaftlichen) Rahmenbedingungen sieht, letztlich aber das kollektive und individuelle Versagen (z.B. in Form von Faulheit und selbstschädigendem Verhalten) für entscheidend hält.
VANCE argumentiert etwa so: „Ja, die Bedingungen sind schrecklich (Struktur), aber die Entscheidung, morgens nicht zur Arbeit zu gehen oder die Kinder zu vernachlässigen, ist eine Entscheidung des Einzelnen (Selbstverantwortung).“
Hier ignoriert er die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über die Auswirkungen von chronischen Belastungen und Armut auf die Funktionen des Gehirns, die für Stressregulation und Selbststeuerung zuständig sind. Vance wertet das Unvermögen, unter extremem Druck „rational“ und „leistungsorientiert“ zu handeln, als moralisches Versagen oder kulturelles Defizit ab.
Dabei spielt natürlich auch die typische “Aufsteiger-Logik” eine Rolle: “Wenn man es selbst geschafft hat, prekäre Bedingungen hinter sich zu lassen, ist damit ja der Beweis erbracht, dass dieser Weg auch allen anderen offenstände.” Das ist nicht logisch, aber trotzdem ein mächtiges Narrativ.
Vance nutzt seine Biografie also eher als Begründung für Härte, nicht für Empathie im Sinne einer Systemänderung. Er sieht sich als Beweis dafür, dass das System funktioniert, sofern man sich den „richtigen“ Werten verschreibt. Damit wird seine Analyse zu einer Rechtfertigung genau jener meritokratischen (leistungsbezogenen) Ideale, die er oberflächlich kritisiert, wenn er gegen „die Eliten“ wettert.
Zurück zum Buch:
Betrachtet man diese Autobiografie einmal unabhängig von den politischen Zusammenhängen, dann findet man eine beeindruckende Milieustudie einer extrem dysfunktionalen Familie in einem kulturell desolaten Umfeld. Dem Autor gelingt es durchaus, einem gesellschaftlichen Problem ein sehr persönliches Gesicht zu geben. In der Art seiner Schilderung drückt sich Verständnis und Empathie für die beteiligten Personen aus, die er – zumindest auch – als Opfer ihrer Lebensumstände wahrnehmen kann.
Dieses Buch hat im ersten Teil ohne Zweifel die Kraft, seine Leser emotional anzusprechen und anzurühren. Dabei entsteht zunehmend auch Unverständnis und Wut über die Rahmenbedingungen, die das alles zugelassen haben.
Diese unmittelbare Wirkung kann die folgende Geschichte des persönlichen Aufstiegs nicht mehr entfalten: Hier finden sich eher die Klischees der “Erziehung durch Härte” (Armee) und “Beziehungen sind alles” (Elite-Uni) wieder.
Zweifellos erhellend ist der tiefe Einblick in die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen, die – auch außerhalb der Slums der Großstädte – in einer Gesellschaft entstehen konnten, die sich gerade auf wirtschaftlicher Ebene als Vorbild für die gesamte Welt gehalten hat.
Dass J.D. VANCE aus seinen persönlichen Erfahrungen die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hat, kann schon innerhalb des Buches bezweifelt werden; aus jetziger Perspektive wohl um so mehr…
(Transparenzhinweis: In zwei Abschnitte dieses Textes sind auch KI-generierte Formulierungen eingeflossen).
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.
“Die Auferstehung” von Andreas ESCHBACH
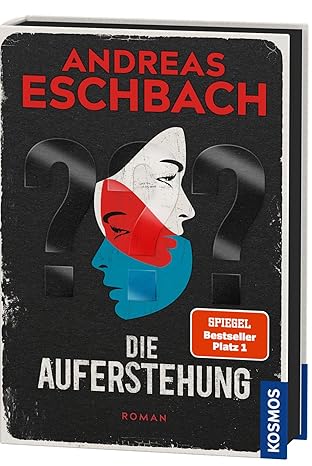
Es ist sicher ein gelungener Marketing-Gag, mit einem aktuellen Krimi an die legendäre “Drei-Fragezeichen-Reihe” anzuknüpfen. Nicht, dass ausgerechnet Andreas ESCHBACH das nötig hätte – aber kommerziell schaden tut es ganz sicher nicht…
Die Transformation der drei Jugend-Detektive in ihr mittleres Erwachsenenalter ist in diesem Buch alles andere als eine Nebensache: Der Bezug zur gemeinsamen Vergangenheit, der dramatische Beziehungsabbruch als junge Twens, seine langfristigen Auswirkungen und die verwickelte Wiederannäherung im Kontext des aktuellen “Falls” stellen die erzählerische Grundlage der Kriminalgeschichte dar.
Die zweite Ebene ist dann der Recherche-Auftrag selbst. Es handelt sich um das mysteriöse Wiederauftauchen einer im brasilianischen Regenwald verschollenen (und totgeglaubten) jungen Frau nach 7 Jahren. Das gleichzeitig eine beträchtliche Erbschaft wartet, lässt die ein oder andere Frage aufkommen.
Wie Zufall und Schicksal (oder der Plot des Autors) es wollen: Die drei Fragezeichen werden – auf völlig unterschiedlichen Wegen – in die Dynamik der Geschehnisse und damit in die Klärung des Falles hineingezogen.
Das alles ist ganz geschickt konstruiert und mit professioneller Erzählroutine beschrieben. Halbwegs niveauvolle Unterhaltung, wenn man mal von der völlig überflüssigen Figur eines Schamanen absieht.
Letztlich handelt es sich um eine eher unspektakulär Story, die davon lebt, dass die 3 Fragezeichen wieder zusammenfinden. Damit bekommt der Titel des Romans eine doppelte Bedeutung…
Wenn man keinen Bezug zu den Vorläufer-Geschichten hat, kann man diesen Krimi ohne großen Verlust ignorieren. Für einen echten (früheren) Fan ist es sicher ein gelungenes Nostalgie-Erlebnis.


