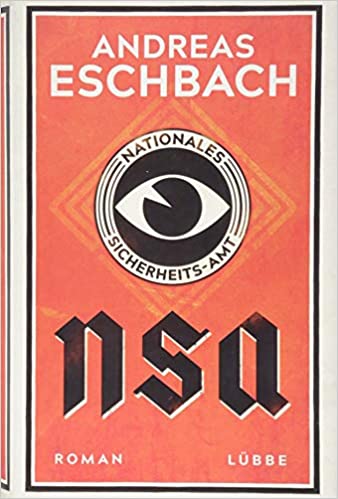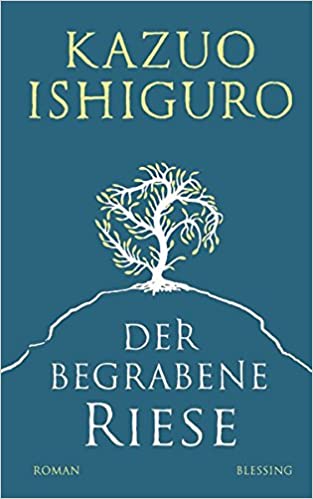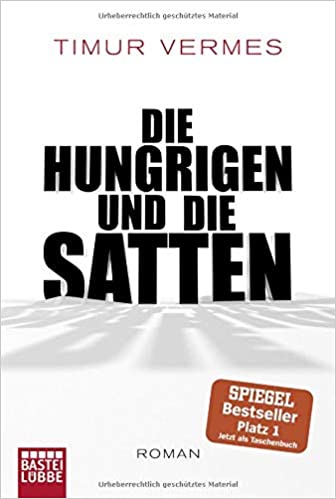
Der aktuelle Bestseller von dem Autor, dessen 2012 erschienener Roman (“Er ist wieder da”) dadurch in die Schlagzeilen und in die Verkaufsregale gelangte, dass er Adolf Hitlers Rückkehr in eine – für ihn verwirrende – Gegenwart zu beschreiben und zu persiflieren versuchte.
Ich habe dieses Buch nie gelesen, weil ich in mir eine – vielleicht altmodisch anmutende – Skepsis gespürt habe, Hitler auf diese Weise zu enttabuisieren oder zu banalisieren. Hitler und Spaß passt für mich irgendwie nicht – das muss vielleicht die nächste Generation hinkriegen…
Doch jetzt geht es um ein anderes Thema, das bzgl. Aktualität und gesellschaftlicher Relevanz kaum zu überbieten ist: Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa.
Auch dieses Buch lebt von einer pfiffigen Idee, auch dieses Buch setzt das Mittel der Satire ein, um – ja …. wozu eigentlich? Um zu unterhalten? Um aufzuklären? Um Denkanstöße zu geben? Um politische Haltungen zu beeinflussen? Wir werden sehen.
Der Plot lebt von der Verknüpfung von drei Themen und Erzählsträngen: Es geht erstens um einen riesigen Flüchtlingstreck, zweitens um das große Geschäft mit Medien (hier am Beispiel eines privaten Fernsehsenders und eines Frauenmagazins) und drittens um die (hilflosen) Versuche der Politik, all dem irgendwie Herr zu werden.
Die entscheidende Verbindung besteht darin, dass der dargestellte große Marsch von Afrika in Richtung Deutschland selbst ein großes, bewusst inszeniertes Medienereignis ist und über viele Monate nach allen Mitteln der Kunst kommerziell gemolken wird. Uns wird – personifiziert durch einen strohdummen, aber extrem populären weiblichen TV-Star, einen Programmdirektor und eine begleitende Frauenblatt-Journalistin – letztlich der Zynismus der Verdummungs-Industrie in immer neuen Varianten vorgeführt. Ach so – natürlich sind auch die meisten Politiker abgezockt und zynisch. Und wenn man genau hinschaut, sogar die führenden Köpfe der Flüchtlings-Bewegung (im wahrsten Sinne des Wortes).
Übrigens: Am Ende läuft nicht alles wie erwartet. Mehr soll hier nicht verraten werden.
Was soll man nun von all dem halten?
Der erste Eindruck: Es gibt von allem sehr viel – manchmal und insgesamt zu viel!
Mit unermüdlichem Erfindungsreichtum arbeitet der Autor sich immer wieder an den gleichen Aspekten ab: Der weibliche Star wird – durchaus mit gelungener Situationskomik – immer wieder neu als naiv, ahnungslos und selbstverliebt entlarvt. Die TV-Macher sind unaufhörlich quotengeil und gehen dabei – nicht nur bildhaft – über Leichen. Und die “Journalistin” liefert immer wieder neue sensationelle und hautnahe Exklusivgeschichten, die vor Kitsch und Klischees nur so triefen.
Das alles ist lustig und manchmal wirklich gut, vielleicht sogar genial auf den Punkt gebracht.
Aber: Wie oft braucht man das?
Um die Mechanismen zu verstehen und sich an der karikaturistischen Fähigkeiten des Autors zu erfreuen, hätte sicher ein Drittel der Beispiele völlig ausgereicht. Gut – der Rest ist dann “mehr desselben” – weil es so spaßig ist…
Das kann man so mögen – dann ist es sicher gute und willkommene Unterhaltung.
Bei einem so brandaktuellen Thema, das unsere Gesellschaft wir kein anderes in den letzten drei Jahren aufgeregt und gespalten hat, darf man vielleicht auch nach der Botschaft fragen. Will uns der Autor etwas sagen? Benutzt er die Mittel der persiflierenden Übertreibung, um uns ein wenig bewusster oder wacher zu machen? Kompetenter im Umgang mit den Herausforderungen?
(Ich habe dazu keine Interviews oder andere Quellen studiert; auch hier leite ich meine Bewertungen nur aus dem unmittelbaren Eindruck ab.)
Ich kann und will dem Autor ein aufklärerisches Motiv nicht absprechen. Das wäre vermessen und vermutlich auch ungerecht. Trotzdem entsteht bei mir als Leser (Hörer) als Grundgefühl etwas anderes. Ich drücke es mal pointiert aus, damit es deutlicher wird (obwohl es auch für mich nur eine Facette ist):
Nutzt nicht dieser Autor das Thema auf seine Weise – nämlich zur Darbietung seiner humoristischen und dramatisierenden Fähigkeiten – nicht letztlich ähnlich aus, wie er das den Medien unaufhörlich vorhält?! Geht er nicht nur einfach eine Ebene höher? Etwas intellektueller?
Oder, anders gesagt: Für mich gerät in dieser extremen Anhäufung von “entlarvender” Komik die Sache selbst aus dem Blickfeld und der Spaß wird zum Selbstzweck.
Ich muss einräumen, dass der letzte Teil des Buches einen etwas anderen Charakter hat, der nicht ganz zu meinem Urteil passt. Aber auch hier geht es um extreme Übersteigerung, die eine Effekthascherei – wie ich finde – deutlich über die Aussage bzw. die Logik der Geschichte setzt.
Man kann über dieses Buch sicherlich trefflich kontrovers diskutieren. Ich freue mich darauf. Zu einem meiner Lieblingsbüchern ist es jedenfalls ganz gewiss nicht geworden.
Eine letzte selbstkritisch Anmerkung: Vielleicht hat sich ja ein wenig Skepsis aus dem (vermiedenen) Hitler-Buch auf dieses Werk übertragen. Man möge es mir nachsehen….