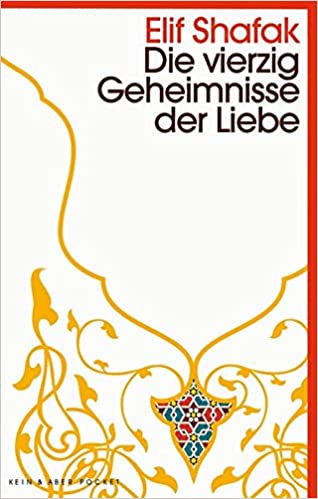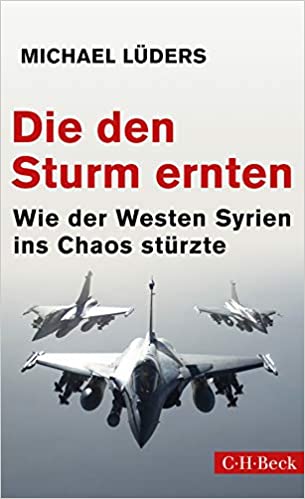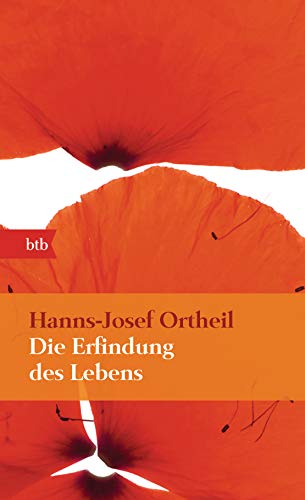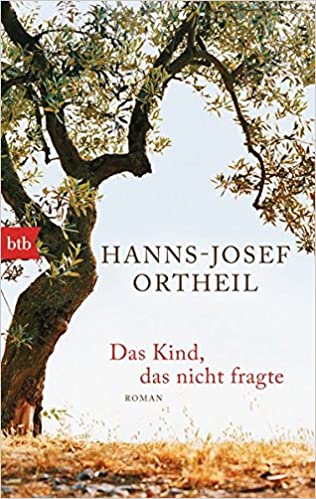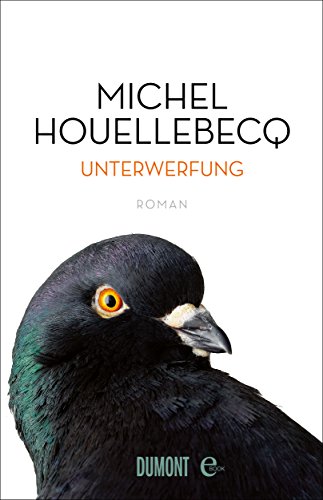Warum bespreche ich ein Buch, das ich niemandem wirklich zum Lesen empfehlen würde?
Weil es von Barack Obama geschrieben wurde, dem amerikanischen Präsidenten, auf den Donald Trump folgte.
Ich war immer ein Obama-Fan – auch in der Zeit, als er als große Enttäuschung oder Mogelpackung belächelt und kritisiert wurde, weil er angeblich entweder nicht geschickt genug taktierte oder nicht radikal genug war.
Ich habe nie verstanden, warum man ihn mitverantwortlich dafür machte, dass sich das rechte, klerikale, rassischste und superreiche Amerika gegen ihn verbündete mit dem einzigen Ziel, ihn scheitern zu sehen. Ich konnte nie begreifen, warum nicht jedem bewusst war, was für ein kaum glaubhaftes Glück es für die USA und die Welt war, einen so intelligenten, charaktervollen und ethisch denkenden Menschen an der Spitze einer Weltmacht zu haben.
Jetzt, wo man weiß, wie schnell so etwas ins Gegenteil kippen kann, gibt es langsam ein Gefühl dafür.
Dieses Buch, in dem Obama 1995 seine komplexe Familiengeschichte erzählt, unterstreicht eindrucksvoll, mit was für einem differenzierten und vielschichtigen Menschen wir es zu tun hatten. Das Buch handelt von seiner rastlosen Suche nach der eigenen Identität in den unterschiedlichen Verästelungen seiner wahrhaft multi-kulturellen Wurzeln. Parallel zu seiner Biografie reflektiert er die schwierige und von Widersprüchen geprägte Herausforderung, als schwarzer Bürger Amerikas seine Rolle und seinen Platz zu finden.
Trotzdem rate ich davon ab, dieses Buch tatsächlich auch zu lesen. Es ist einfach zu detailliert und damit auch zu weitschweifig – zumindest wenn man selbst (z.B. als weißer Mitteleuropäer) von den angesprochenen Themen nicht unmittelbar betroffen ist. Natürlich gibt es immer wieder auch zusammenfassenden Betrachtungen und Schlussfolgerungen – aber sie gehen unter in einem Wust von minutiösen Schilderungen von Personen und Begebenheiten.
Was bleibt ist die Gewissheit, dass ein Mensch amerikanischer Präsident war, der von dem jetzigen Amtsinhaber wirklich unfassbar weit entfernt ist. Dass diese beiden extremen Verkörperungen von dem, was Amerika sein kann, an der wichtigsten Schaltstelle der Welt unmittelbar aufeinanderfolgen, ist eine wahrlich verrückte Pointe der Geschichte.