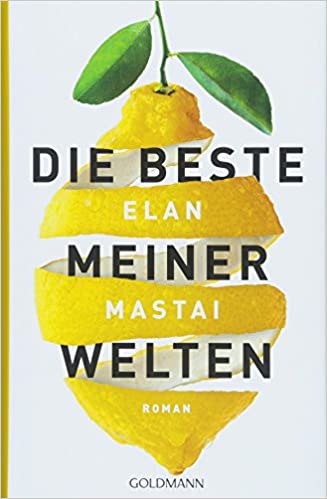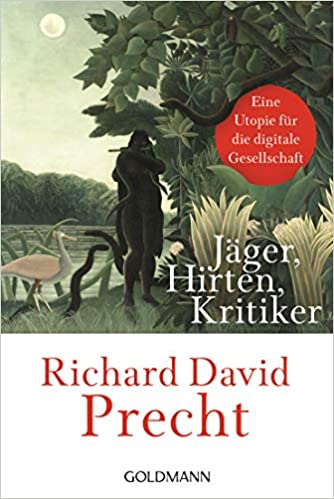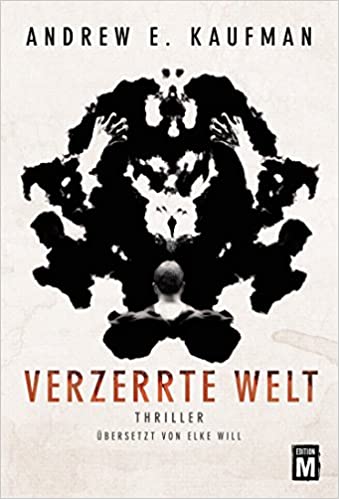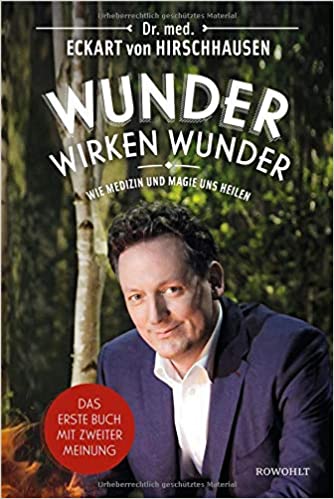Schon wieder Science-Fiction?! Kann der Typ nicht mal wieder normale Bücher besprechen? Kann ich, kommt auch wieder. Aber dieses Buch kann und will ich euch nicht vorenthalten.
Noch vor wenigen Tagen war ich begeistert über den Zeitreisen-Roman von Elan MASTEI. Daher gestaltete sich der Start in das neue Buch etwas zögerlich. Was sollte danach schon noch kommen – außer einem Knick nach unten? Aber es kam anders.
Genug der Vorreden – ich sollte wohl weniger über mich und mehr über die Bücher schreiben…
Als Warnung an die Fans von Zukunfts-Technik: Der Science-Fiction-Anteil ist eher klein; er beschränkt sich weitgehend darauf, eine Rahmenhandlung zu liefern. Es geht um unseren bescheidenen Planeten.
Ein Alien wird auf die Erde geschickt. Seine Mission: Er soll verhindern, dass sich die Menschheit als Folge eines mathematischen Geniestreiches technologisch weiterentwickelt. Aus guten Gründen ist nämlich die weit überlegene Gattung aus einer fernen Ecke des Universums der Überzeugung, dass die Erdenbewohner ganz sicher nicht die notwendige emotionale und moralische Reife besäßen.
Also schlüpft ein Abgesandter der wohlmeinenden Aufpasser in die Gestalt und Rolle des überschlauen Mathematik-Professors, um in seinem Umfeld alle Spuren der spektakulären Erkenntnis zu tilgen.
Eigentlich wäre das eine Kleinigkeit für das mit Super-Kräften ausgestattete Alien in Professoren-Gestalt. Aber – man hat die Rechnung ohne die zweite Seite des menschlichen Seins gemacht! Der Mensch an sich ist nämlich nicht nur dumm, gierig und gewalttätig (das ist er ohne Zweifel auch) – sondern er ist auch ein fühlendes, empathisches und liebendes Wesen. Und seine einzigartiger Wert liegt gerade darin, dass er nicht perfekt, nicht unsterblich, nicht streng logisch-rational und nicht immun gegen Schmerz und Leid ist!
Kurz gesagt: Das Buch ist eine intelligente und anrührende Liebeserklärung an das menschliche Dasein – mit all seinen Unvollkommenheiten und Widersprüchlichkeiten. Es ist ein durch und durch menschenfreundliches Buch und weckt Aufmerksamkeit und Respekt für die alltäglichen Geschenke des Seins.
Natürlich wird hier der Plot nicht verraten. Schließlich sorgt so eine Handlung dafür, dass man bis zu Ende durchhält. Es geht um Liebe, um einen schwierigen Jugendlichen und einen liebenswerten Hund. Und natürlich gibt es auch echte Gefahren für alle Beteiligten.
Über allem steht die Einladung, die Chancen des Lebens wahrzunehmen und zu ergreifen – und dabei die richtigen Prioritäten zu setzen.
Dass damit die Glitzerwelt des Konsums, die kritiklose Übernahme irgendwelcher Ideologien oder die Dauerberieselung durch verdummende Medien nicht gemeint ist, kann der Autor überzeugend darstellen.
Gut – vermutlich könnte man dem Buch auch ein wenig Verklärung und Kitsch-Nähe anlasten; vielleicht ist manches zu vorhersehbar und idealisiert.
Vermutlich wäre dem Alien die Wandlung zum Menschen-Fan erspart geblieben, wenn er in irgendeinem übervölkerten Großstadt-Ghetto oder in einem Bürgerkriegs-Gebiet gelandet wäre – statt im gemütlichen Mittelschicht-Cambridge.
Aber geschenkt – es geht ums Prinzip! Ein im besten Sinne menschliches Leben ist möglich – trotz aller Unwahrscheinlichkeiten und Absurditäten des unendlichen Kosmos. Schon das ist ein unfassbares Wunder. Und genau dafür öffnet der Autor die Augen. Unterhaltsam – aber spürbar auch mit einem gewissen missionarischen Anspruch.
Bücher wie dieses können vielleicht tatsächlich dazu beitragen, dass ein paar Menschen mehr sich auf den Weg begeben, nach den wahren Schätzen dieser Welt Ausschau zu halten. Was könnte man als Autor mehr erreichen wollen!