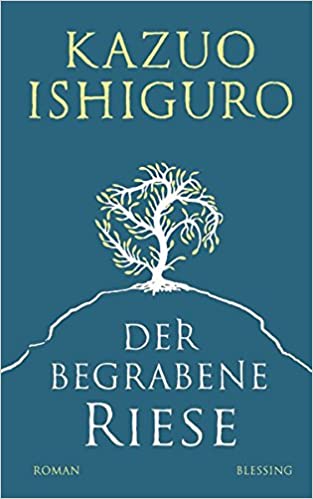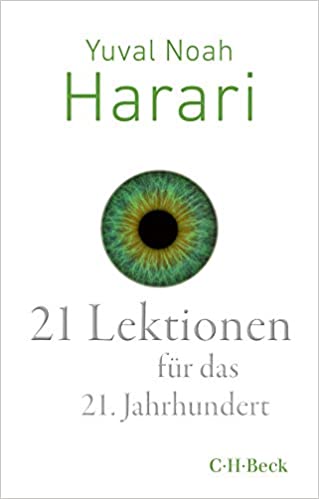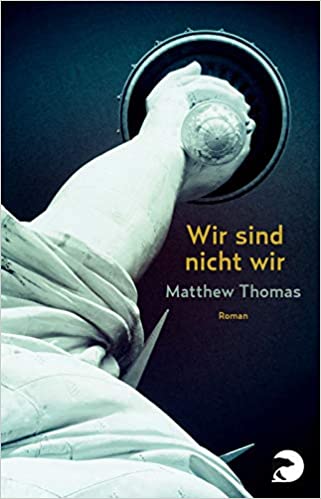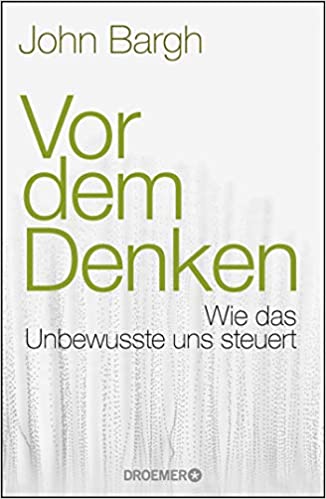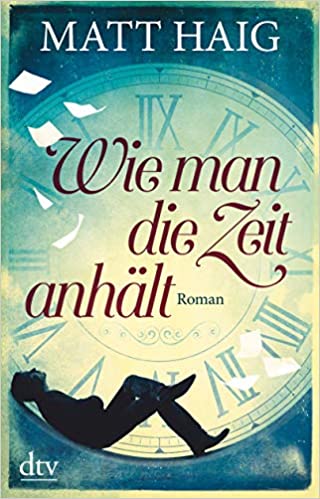Der Leser / die Leserin meines Bücher-Blogs wird sich vielleicht fragen: Warum lese (höre) ich überhaupt so ein Buch – wo es doch unzählige “wertvollere” literarische Themen und Texte in der Warteschlange gibt?
Nun: Udo Lindenberg ist ein Teil meiner persönlichen Zeitgeschichte, musikalisch, politisch und bezogen auf Konzertbesuche. Es gibt dadurch eine Art von Verbundenheit, die als Motivationsquelle für die Beschäftigung mit seiner aktuelle Biografie völlig ausreicht.
Viele – etwas jüngere Menschen – haben Udos erste musikalische Schaffensphase nicht “live” verfolgen können. Sie haben ihn eher als ein öffentliche Figur kennengelernt, die irgendwo zwischen einer schon etwas angestaubten Galionsfigur des “Deutsch-Rocks” und einem insgesamt sympathischen Politclown durch die Medienwelt geisterte. Udo war irgendwie schon früh sein eigenes Denkmal, der durch die gut gepflegten Attribute seines Markenzeichens die Jahrzehnte überdauerte.
Übersehen wird dabei, dass er Anfang bis Mitte der 70iger einige musikalisch und textlich überragende Platten angeliefert hat, die heute noch fast alles in den Schatten stellen, was je in deutscher Rockmusik produziert wurde.
Ach so – das Buch!
Nach einem kurzen Einstieg in der Come-Back-Phase stellt die (Auto-)Biografie das private, musikalische und öffentliche Leben des Künstlers facettenreich und detailverliebt dar. Das ist zunächst alles ganz interessant und unterhaltsam. Man staunt, wie früh der jugendliche Udo damals schon in die Musik-Szene eingetaucht ist (wie die meisten wissen werden, als Jazz-Schlagzeuger) und wie übergangslos er von dem Alkoholismus seines Vaters in die eigene Säufer-Karriere gerutscht ist.
Da wären wir auch schon beim entscheidenden Stichwort: “Alkohol”.
Sowohl das persönliche Leben von Udo als auch dessen literarische Beschreibung leiden an diesem Thema. Selbst der gutmütigste Leser wird irgendwann ermüden oder verzweifeln an der nicht enden wollenden Schilderung von Alkohol-Exzessen, kurzen Ausstiegsversuchen und ewigen Rückfällen. Es ist wirklich nur schwer erträglich und irgendwann – wenn die Fassungslosigkeit abgeklungen ist – einfach auch langweilig.
Eine besondere Rolle spielt in der Darstellung die Rolle von Udo als ziviler Kämpfer für die Durchlöcherung der innerdeutschen Mauer – exemplarisch ausgetragen in dem zähen Kampf um eine Auftrittserlaubnis im abgeschotteten Osten. Seine besondere “diplomatischen” Beziehung zu Erich Honecker wird ausführlich beschrieben – ebenso wie die große symbolische Bedeutung, die Udo für seine treuen Fans in der DDR hatte.
Natürlich ist das Buch so aufgebaut, dass es ja nicht auf ein endgültiges Scheitern dieser zwiespältigen Figur hinausläuft, sondern auf das große Come-Back. Es erscheint wirklich fast wie ein Wunder, dass dieser kaputte Typ nochmal ganz nach oben kam. Die Geschichte dieses “letzten Aufbäumens” gehört sicher zu den informativen Teilen dieses Buches.
Bleibt die Bilanz:
Für Udo-Fans eine Menge Infos aus dem sehr persönlichen Umfeld. Für den allgemein Interessierten eine Portion Zeitgeschichte. Für den Musik-Liebhaber ein wachsendes Unverständnis und Unbehagen angesichts der scheinbar so dominanten Rolle des Alkohols in dieser Subkultur.
Persönliche Schlussbemerkung:
Ich kann mich nicht davon freimachen, dass der Respekt vor der Person Udo doch ein wenig gelitten hat. Eignen sich solche Menschen wirklich als Vorbilder bzw. Idole; als Instanzen, die der Jugend Orientierung geben können?
Anderseits: Vielleicht erreicht so jemand wie Udo gerade deshalb – wegen der eigenen Unvollkommenheit und inneren Zerrissenheit – eben auch Gruppen, die sonst gar nicht oder durch weitaus gefährlichere Verführer angesprochen würden.
Er steht ja doch irgendwie auf der richtigen Seite!
Die Bewertung der aktuellen musikalischen Leistung findet sich hier.