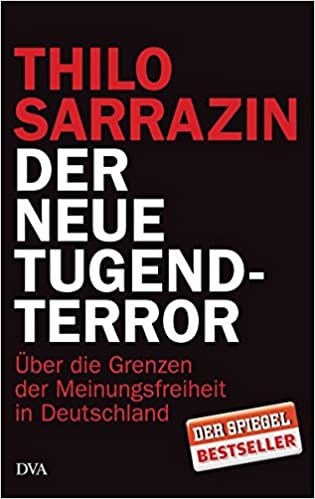Nehmt euch etwas Zeit; es ist die längste Rezension, die ich jemals geschrieben habe.
Ich stelle mir gerade vor, wie ihr vielleicht diesen Link aus Protest erst gar nicht geöffnet habt, euch möglicherweise verwundert die Augen reibt (Fehlwahrnehmung?) oder ihr euch schon mit einer gewissen Vorfreude auf einen vernichtenden Verriss dieses Buches einstellt.
Wie anders sollte man denn umgehen mit diesem viel-verschmähten Autor, der mit seinem ersten provokanten Buch (“Deutschland schafft sich ab”) zur Galionsfigur für das “Abschotten” gegenüber einer vermeintlich bedrohlichen Migrationswelle geworden ist. Schließlich versucht die SPD seit Jahren, dieses unbequeme Mitglied loszuwerden, weil seine Thesen insbesondere bei den politischen Gegnern am rechten Rand als hochwillkommene argumentative Munition genutzt werden.
Ich werde in dieser Rezension solchen Erwartungen nicht entsprechen und gehe damit ein gewisses Risiko ein – insbesondere das Risiko, Unverständnis, Ablehnung und vielleicht sogar Besorgnis auszulösen. Macht sich da – so könnte sich mancher fragen – jemand ganz allmählich auf den Weg zu anderen politischen Gefilden? Driftet Frank – zusammen mit dem Mainstream der Gesellschaft – langsam nach rechts?
Das Schreiben dieser Buchbesprechung ist tatsächlich eine kleines persönliches Abenteuer – auf vermintem Gelände. Ich bin selber gespannt, bei welchen Formulierungen ich letztlich landen werde. Was ich mich traue, unmissverständlich auszusprechen; was ich lieber gut verpackt darbiete; was ich alles unternehme, um Missverständnissen vorzubeugen…
Man könnte auch fragen: Wie stark empfinde ich den Druck der political correctness und in welchem Ausmaß lasse ich mich dadurch beeinflussen?
Jedenfalls spüre ich: Der einige sichere Weg wäre es, diese Rezension einfach sein zu lassen. Doch irgendwas in mir wehrt sich dagegen: Sollen etwa durch eine solche Selbstzensur diejenigen Recht bekommen, die dauernd lamentieren, dass der “linke Gesinnungsterror” eine offene gesellschaftliche Auseinandersetzung verhindere?!
Der Zufall hat mich zu diesem Buch geführt: Ich habe es bei einer Haushaltsauflösung in die Hände bekommen. Es hat mich etwas neugierig gemacht, ich hab es mitgenommen, weil es so aktuell war. “Einfach mal reingucken und die eigene Meinung bestätigen”, habe ich gedacht – und es dann innerhalb von drei Tagen gelesen.
Während der Lektüre war ich mit drei Ebenen gleichzeitig beschäftigt: mit dem Inhalt, mit der Auswirkung auf mein Weltbild und mit dem Gedanken an die bevorstehende Herausforderung, eine Rezension zu schreiben.
Insgesamt eine intensive Erfahrung!
Exkurs:
Warum schreibe ich so viel über mich, wenn ich angeblich ein Buch besprechen möchte?
Nun, mein Motiv ist es grundsätzlich nicht, rein sachlich-neutrale Rezensionen zu schreiben. Davon gibt es genug (z.B. bei Amazon); außerdem können das andere besser. Für mich ist die “Interaktion” zwischen dem Buch und mir das spannende Thema: Was macht das Buch mit mir? Warum bereichert es mich – gerade an diesem Punkt meiner persönlichen Entwicklung? Warum regt es mich so auf?
Ich gehe davon aus, dass die paar treuen Leser, die ich habe, genau daran auch ein gewisses Interesse haben. Wenn ihr nicht auch einen Gewinn darin sehen würdet, mit jeder Rezension auch ein wenig von mir zu erfahren, hättet ihr schon längst aufgehört, die Links auf die Beiträge zu öffnen, oder….?
Jetzt fange ich an:
Die Kern-Aussage des Buches lässt sich leicht zusammenfassen: “Der Islam ist vom Grundsatz her (Ausnahmen bestätigen die Regel) eine rückständige, bildungs- und fortschrittsfeindliche, intolerante, frauenverachtende, demokratieferne, integrationsunfähige und auf militante Machterweiterung ausgelegte Religion. Da Muslime auch noch (weltweit und konstant) eine deutlich höhere Geburtenrate haben als andere Gruppen, ist es falsch und gefährlich, der Einwanderung von muslimischen Migranten keine engen Grenzen zu setzen. Wenn man das nämlich nicht tut, lebt man über kurz oder lang in einem anderen Land, weil die Hoffnungen auf eine echte Eingliederung in unsere Gesellschaft und deren Grundwerte bisher nicht aufgegangen sind .”
Natürlich würden solche – aus dem Zusammenhang gerissene – Aussagen berechtigten Widerspruch hervorrufen. Je nach Geschmack könnte man solche Thesen als “einseitig”, “zugespitzt”, “polemisch”, “undifferenziert”, “übertrieben”, “verleumderisch”, “fremdenfeindlich”, “rechtsradikal”, “rassistisch” oder “menschenverachtend” brandmarken.
An all diesen Vorwürfen wäre sich auch etwas dran.
Was aber – und jetzt wird es eine Stufe komplizierter – wenn der Urheber solcher provokanten Thesen auf knapp 500 Seiten unaufhörlich – auf den ersten Blick plausible – Belege für seine Analysen bzw. Behauptungen anführt?
Sollte oder müsste man sich – wenn man seine Schlussfolgerungen so spontan ablehnt – überhaupt noch mit diesem Material auseinandersetzten? Sind auch solche Fakten relevant, die zu ungeliebten Konsequenzen führen könnten? Muss man nicht den Anfängen wehren – selbst wenn sie erstmal auf faktenbasierten Recherchen beruhen?
Auch wenn man SARRAZIN nicht mag – auch ich finde ihn sehr unsympathisch – muss man zunächst zugestehen, dass er in seinem Buch sehr gründlich und systematisch vorgeht. Es ist ein extrem faktenreiches Buch, vollgespickt mit Quellenangaben, Statistiken, Tabellen und Zitaten.
Die Systematik des Vorgehens spiegelt sich schon in der Gliederung:
SARRAZIN startet – nur so ist es konsequent – mit dem Koran. Natürlich hat er ihn (angeblich) ganz gelesen. Seine – von zahlreichen Zitaten unterlegte – Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass die Auslegungsversuche, die in der “heiligen Offenbarung” der Moslems Hinweise auf eine friedliche, menschenfreundliche und tolerante religöse Botschaft zu finden glauben, insgesamt einer realistischen Grundlage entbehrten. Einzelnen Textstellen, die sich so interpretieren ließen, stände eine überbordende Vielzahl von Aussagen entgegen, die den kämpferischen Alleinanspruch der Heilslehre unter Beweis stellten.
Der Autor wendet sich als nächstes der Entstehungs- und Ausbreitungsgeschichte des Islams zu, um dann einen Überblick über die islamisch geprägten Regionen der Gegenwart zu geben – in Hinblick auf deren gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Besonderheiten. Das alles passiert nicht in einem oberflächlichen Schnelldurchgang, sondern auf ca. 50 informationsintensiven Seiten.
Auf den nächsten ca. 100 Seiten fast SARAZIN dann seine Resümee bzgl. der typischen “Problemzonen” islamischer Gesellschaften zusammen, wobei insbesondere der Widerspruch zwischen der islamisch geprägten Kultur und den Ansprüchen und Vorzügen der Moderne (aufgeklärtes Weltverständnis, Menschenrechte, Gleichberechtigung, Freiheit des Denkens, Freude an Wissen und Bildung, Trennung von Religion und Staat, usw.) herausgearbeitet wird.
Bis hierhin ist das Buch mehr eine – sicher einseitige und pointierte – Analyse von äußeren Gegebenheiten, über die man unter Experten zwar trefflich streiten könnte, die aber keinen großen Staub aufwirbeln würde.
Auf den nächsten knapp 200 Seiten wird es dann hochpolitisch: Dann ab jetzt geht es um die Situation der Muslime in den Staaten, in denen sie durch Einwanderung (und später auch durch Flucht) zu einer mehr oder weniger bedeutsamen Minderheit geworden sind. Auch hier werden erstmal jede Menge Zahlen (über religöse Haltungen, Bildung, politische Einstellungen, Geburtenraten und Kriminalität) zusammengetragen, deren Bewertung – im Sinne von Fehlentwicklung und Risiken – jedoch immer eindringlicher formuliert wird.
Das Buch gipfelt dann in Schlussfolgerungen und Forderungen, die man angesichts des “offiziellen” politischen Diskurses nur als “radikal” einordnen kann – was nicht automatisch heißt, dass sie sich alle einer inneren Logik und einer Nachvollziehbarkeit völlig entzögen. Letztlich geht es SARRAZIN – und da schließt sich die Verbindung zum Umfeld der AfD – um die Verhinderung einer “feindlichen Übernahme” durch eine mehr und mehr islamisch geprägte gesellschaftliche Gruppe. Da ist sie auf einmal – die drohende “Überfremdung”. Diesmal nicht als rechter Kampfbegriff, sondern als – scheinbar logisches – Ergebnis von 500 Seiten Weltanalyse.
Ich bin nicht in der Lage zu beurteilen, ob all diese aufgeführten Informationsquellen einseitig und “unfair” ausgesucht sind; ich kann nur auf die pure Quantität hinweisen.
Der Autor hat ein klares Anliegen; er macht durchaus offen, dass er von etwas überzeugt ist und mit diesem Buch überzeugen will. Das ist zumindest transparent.
SARRAZIN bemüht sich immer wieder, einem gewissen wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden, indem er darauf hinweist, dass die Daten eine bestimmte Interpretation nicht beweisen – aber eben aus seiner Sicht sehr nahe legen. Er spricht an, dass korrelative Zusammenhänge keine Ursachen belegen, dass andere Deutungen möglich wären.
Der Autor versucht permanent, zu erwartenden Einwänden zuvor zu kommen. Er räumt ein, dass es Ausnahmen gibt (z.B. was die eher orthodoxe Interpretation des Koran und das Fehlen einer “islamischen Aufklärung” angeht), macht aber unmissverständlich (und jeweils begründet) deutlich, dass dadurch die “Regel” nicht außer Kraft gesetzt wird.
Vom Stil agiert hier nicht ein wutschäumender Polemiker, sondern ein Überzeugter, der offenbar in aller Ruhe seinen Argumentationsstrang entfalten kann, weil er die erdrückende Macht der Fakten auf seiner Seite spürt.
Etwas kritischer formuliert könnte man auch sagen: SARRAZIN lullt den Leser erstmal auf vielen, vielen Seiten mit faktenbasierten Analysen ein, um dann sehr weitgehende Schlussfolgerungen und politische Forderungen zu formulieren, die vor diesem Hintergrund dann den Heiligenschein der wissenschaftlichen Seriosität bekommen.
Tatsächlich würden die gleichen Forderungen (z.B. “Rückführung von Flüchtlingen ohne Bleiberecht in aufnahmeunwillige Herkunftsstaaten unter militärischer Begleitung”) in einem Parteiprogramm oder in einer Talkshow eine Protestwelle hervorrufen.
Hier ist einer konsequent bis über die Schmerzgrenze hinaus. Das kann man mögen (und irgendwie “ehrlich” finden), man kann aber auch zu dem Schluss kommen, dass sich da jemand aus einem ernsthaften Diskurs verabschiedet. Nur: Wenn man sich – aus guten Gründen – für die zweite Alternative entscheidet, dann ist man damit nicht aus der Pflicht, andere – und möglichst realistische – Lösungsvorschläge zu machen.
Kann es sein – so wird sich der aufmerksame Leser fragen -, dass dieser Autor mir an manchen Stellen “sogar aus dem Herzen” spricht?
Tatsächlich, auch das kommt vor. Ich teile seine Kritik an und der Ablehnung von religiösem Eifer und Fundamentalismus. Auch ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der faktenbasierte Entscheidungen getroffen und Wahrheiten nicht in der buchstabengetreuen Auslegung uralter Texte gesucht werden. Ich möchte keinen Einfluss ausländischer Staatsführer über den Schleichweg der Religion. Ich möchte statt einem staatlich kontrollierten Islam-Unterricht an unseren Schulen eine überkonfessionelle Wertevermittlung, die natürlich auch den Respekt vor Religionen beinhaltet.
Ich möchte in einer Kultur leben, die zwar nicht dem uferlosen Egozentrismus und einem pervertierten Materialismus nachjagt, die aber dem Denken keine von anderen kontrollierten Fesseln anlegt und zur kritiklosen Unterordnung unter vormittelalterlichen Prinzipien erzieht.
Tatsächlich kann ich nach dem Lesen dieses Buches mit noch einem sichereren Gefühl als vorher sagen: Ich möchte auch zukünftig nicht in einer maßgeblich vom Islam geprägten Gesellschaft leben!
Die entscheidende Frage ist für mich allerdings offen: Wie realistisch sind die beschriebenen Trends wirklich und wie weit müssen demnach “Gegenmaßnahmen” gehen? Und welche Gefahren wären wiederum damit verbunden?
Gibt es sowas wie ein persönliches Resümee?
Für mich ist es entscheidend, die Themen auseinander zu halten.
Für mich macht es einen Unterschied, ob ich mich über humanitäre Hilfe, also die Verantwortung für Menschen in Not, unterhalte oder über die Kriterien für eine geplante Einwanderungspolitik. Es ist für mich nicht dasselbe, einzelnen Muslimen Respekt vor Ihrer religiösen Überzeugung zu zollen (selbstverständlich!) oder mir Gedanken über die Begrenzung des Einflusses des Islam in unserer Gesellschaft zu machen (durchaus legitim).
Das Wichtigste ist aber: Wie kann man auf die Idee kommen, aus Sorge vor Überfremdung, finanzieller Überforderung oder Kriminalität die Achtung vor Leib und Leben realer Menschen in Frage zu stellen?! Hier muss es unverrückbare Stoppschilder geben! Und zwar von jedem, der sich zu dieser Thematik äußert!
Und wenn man – ein durchaus berechtigtes – Interesse daran hat, sich im “eigenen” Land nicht fremd zu fühlen und sich nicht berufen fühlt, die Not anderer Menschen dadurch zu mildern, dass am ihnen einen Platz in Deutschland einräumt, dann steht man in der Verantwortung, realistische Alternativen dafür zu entwickeln.
Dabei räume ich gerne ein, dass auch der deutsche Wohlstand nicht die ganze Welt retten kann und nicht alle bedrohten und notleidenden Menschen bei uns Platz haben. Aber die deutsche Politik könnte wesentlich dazu beitragen, dass der ungeheure Reichtum auf dieser Welt, der sich immer stärker in den Händen weniger Konzerne und Superreichen konzentriert, für die menschheitsrelevanten Ziele eingesetzt wird.
Wir haben die Ressourcen, diese Welt wesentlich besser zu machen; wir nutzen sie nur nicht.
Zu diesen Fragen finden sich im Buch von SARRAZIN nur einige läppische Sätze, die mehr oder weniger eindeutig auf die Selbstverantwortung der Staaten und ihrer Bevölkerung hinweisen, aus denen Flüchtlinge kommen. Das ist zu billig, Herr SARRAZIN!
Dieses Buch ist ohne Zweifel wichtig. Nicht, weil es “gut” wäre oder “zutreffend” – sondern weil es die theoretische und intellektuelle Basis für eine gesellschaftliche Bewegung darstellt, die inzwischen zu einem realen politischen Machtfaktor geworden ist. Wenn die hier dargelegte Argumentation stichhaltig wäre, dann hätten auf einmal Leute “Recht”, die man sonst (für sich) als unaufgeklärt, verirrt und insgesamt irrelevant aussortiert hat.
Die Thesen und Schlussfolgerungen dieses Buches zu ignorieren oder einfach pauschal als “rechtsradikal” abzutun, wäre dumm und gefährlich. Weil es der anderen Seite das Feld überlassen würde, weil es Wahrnehmungen von Denk- bzw. Sprechverboten stärken würde, weil es zu einer Verfestigung der Spaltung beitragen würde und weil es vielleicht auch die eigenen blinden Flecken pflegen würde.
Aber: Dieses Buch ist auch gefährlich. Weil es zu wenig die Grenzen markiert, die es zwischen einer abstrakten Betrachtung von Tendenzen/Risiken und den Umgang mit konkreten Menschen geben müsste. Weil es keine echte Verantwortung für die Herausforderungen übernimmt, die außerhalb unseres Landes bestehen.
Dieses Buch baut ein Bedrohungsszenario auf, das zwar in Einzelaspekten einer offenen Diskussion bedurfte, dass aber in seiner Massivität durchaus als Basis für “Notwehrmaßnahmen” missbraucht werden kann und missbraucht wird. Es deshalb zu ignorieren, ist m.E. nicht die Lösung.
Ungelöst bleibt letztlich die Frage, wie man differenzierte Sichtweisen in ein politisches Klima einbringen kann, das auf polemische Zuspitzungen gebürstet ist.
Kann und darf man damit das eigene Profil aufweichen, das doch auch die Grundlage von Sicherheit und Solidarität in einer definierten Bezugsgruppe darstellt?
Darf man Probleme und Risiken einräumen, die andere zu unakzeptablen Haltungen und menschenfeindlichen Reaktionen treiben? Oder basiert diese abstoßende und gefährliche Zuspitzung vielleicht gerade darauf, dass man abwägende Haltungen so stark ausgrenzt, dass sie sich nur noch in einem hässlichen Umfeld beheimatet fühlen?
Reicht es wirklich auf Dauer, eindeutig anti-rassistisch, weltoffen und solidarisch zu sein? Wird man damit auch in Zukunft jede Diskussion um das Management von Flüchtlingsströmen bestehen?
Für mich sind das offene Fragen. Wenn dieser Artikel jetzt vor einem größeren Publikum erscheinen würde, bekäme ich schnell eine Rückmeldung dazu. Vermutlich würde sich ganz schnell der übliche Schlagabtausch radikaler Meinungen ergeben.
Auf eure – sicher differenzierteren – Meinungen bin ich gespannt.
(Ich habe auch diese Rezension geschrieben, ohne mir vorher eine einzige andere Bewertung des Buches anzuschauen. Ich werde das jetzt nachholen und bin darauf sehr gespannt).
Nachtrag:
Ich habe jetzt in die Amazon-Leserrezensionen geschaut.
Es ist ein Phänomen!
Bei kontroversen Themen ist es meist so, dass die Bewertungen weit auseinander gehen – je nach Einstellung der Leser.
Für SARRAZIN gibt es fast ausschließlich gute Bewertungen.
Für mich ist das eine Bestätigung, dass diese Bücher von Andersdenkenden tatsächlich nicht gelesen werden, sie werden boykottiert.
Tatsächlich drückt sich die Spaltung der Gesellschaft auch an diesem Punkt aus.
Wenn man diese Spaltung verstehen – und vielleicht sogar ansatzweise überwinden will – ist es aus meiner Sicht durchaus sinnvoll und lohnend, sich mal auf die andere Perspektive einzulassen, auch mal intensiver.