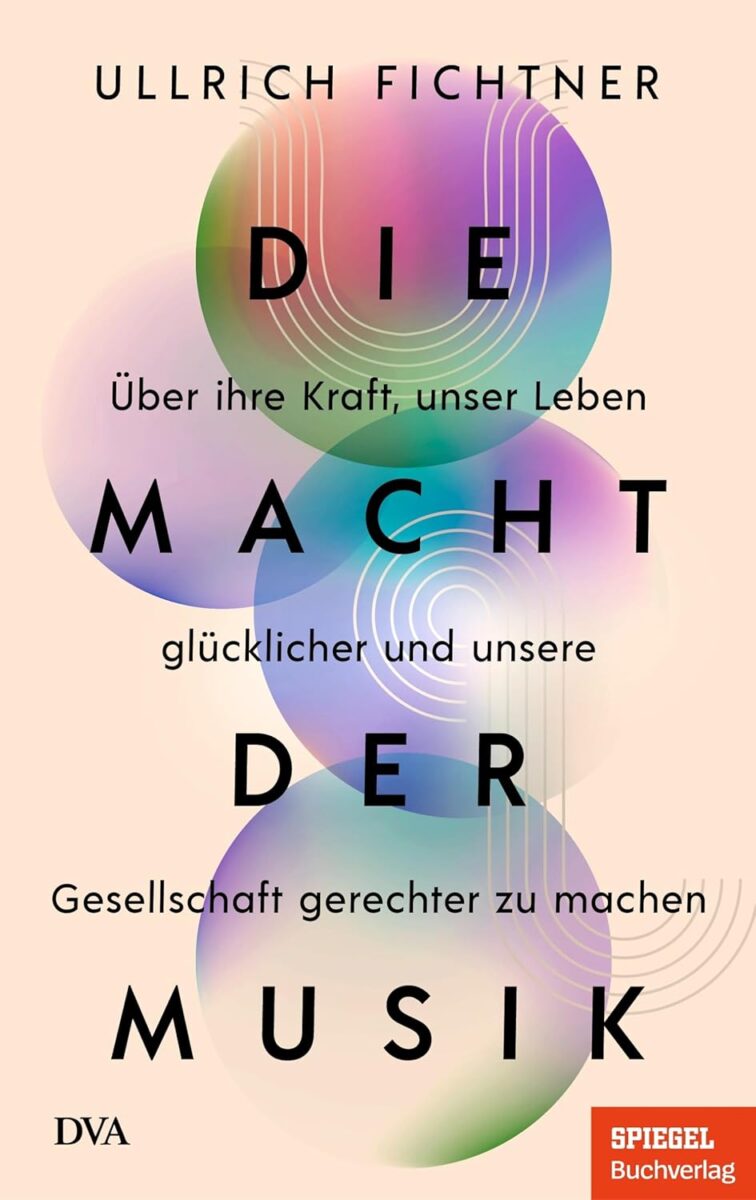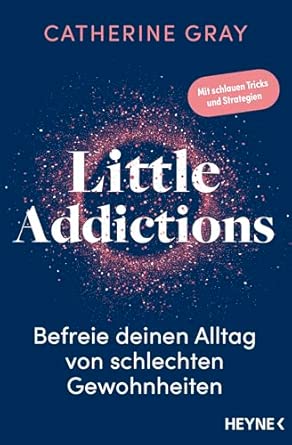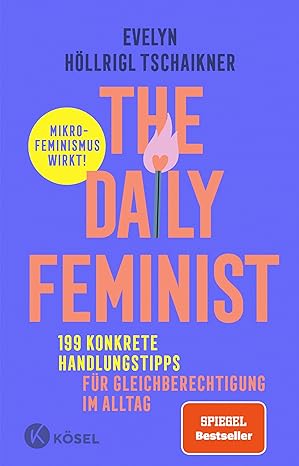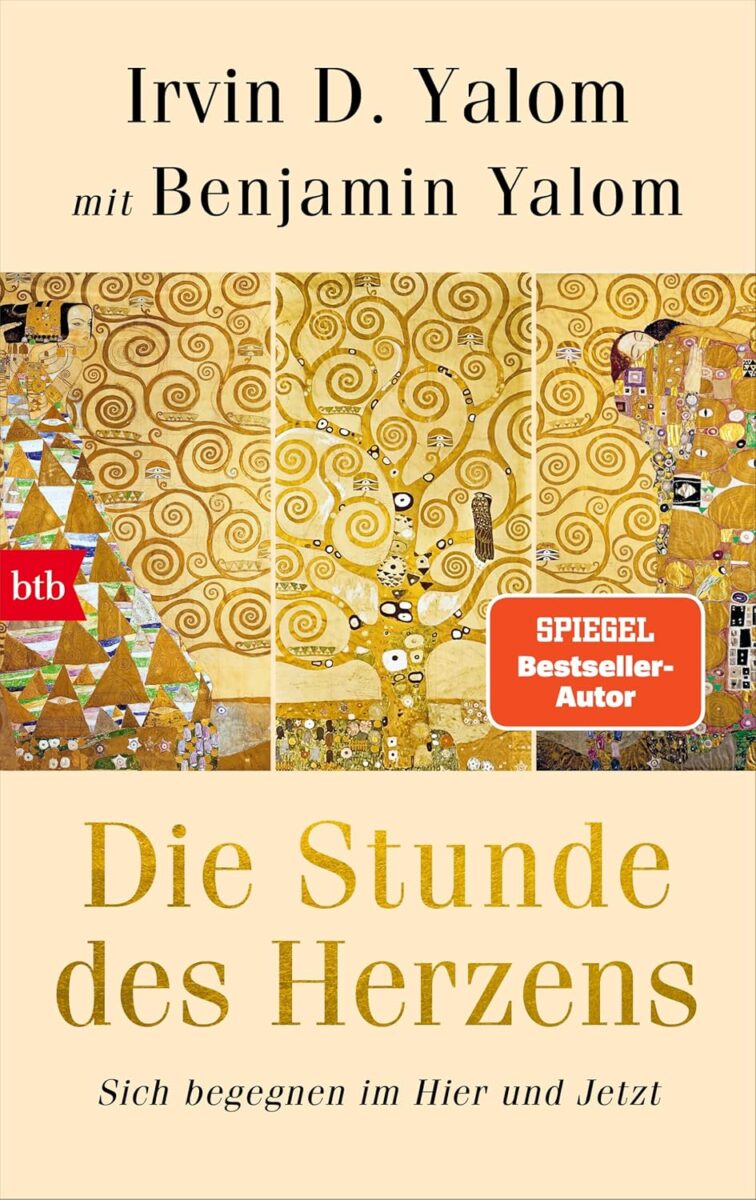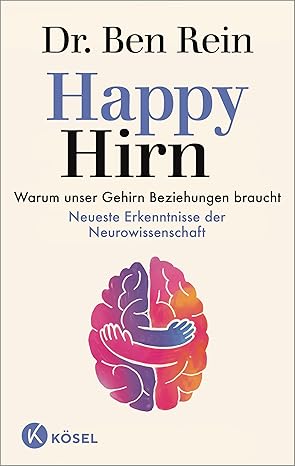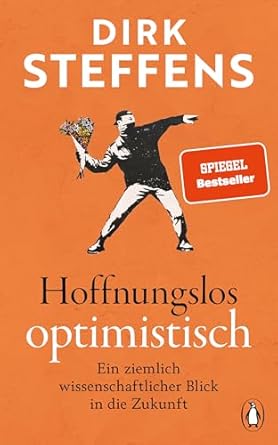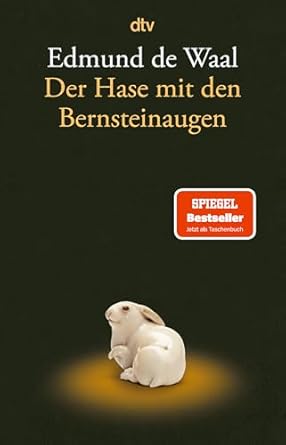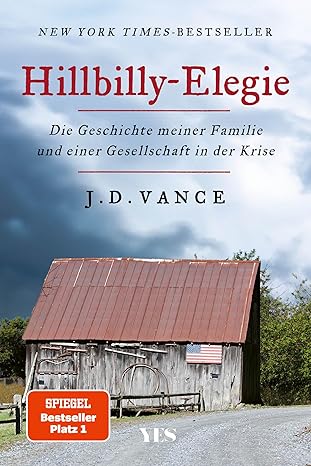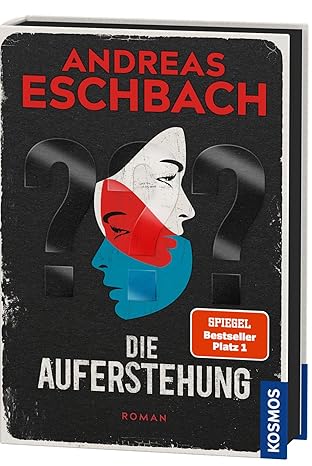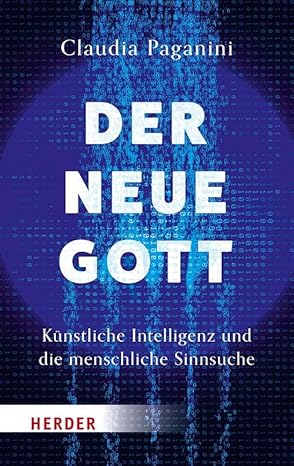
Eine spannende Fragestellung mitten im KI-Hype: Ist die Künstliche Intelligenz auf dem Weg, traditionelle Gottesbilder zu ersetzen? Steuern wir also zu Beginn des 3. Jahrtausend unserer Zeitrechnung auf eine neue Form der Göttlichkeit zu?
Dass die Autorin diese Frage ernst und wörtlich meint, lässt sich zunächst daran ablesen, dass sie Philosophin und Theologin ist. Für sie ist der Bezug zur Begrifflichkeit “Gott” also nicht nur eine publikumswirksame Metapher, sondern sehr konkret hinterlegt.
Noch deutlicher wird dann der theologische Bezug, wenn man in den Text einsteigt: PAGANINI liefert für den Rahmen ihrer Betrachtungen zur Rolle der KI nämlich nicht weniger als einen ziemlich detaillierten religionsgeschichtlichen Grundkurs. Sie führt die Leserschaft durch die kulturellen Stufen der Ausgestaltung von Göttlichkeit – beginnend bei ersten animistischen Naturgeistern bis hin zu den weltumgreifenden monotheistischen Gottesfiguren.
Die Autorin hat sich für die Untersuchung ihrer Hypothese eine Systematik ausgedacht, die einer Wissenschaftlerin zur Ehre gereicht: Sie hat sich die Grunddimensionen der alleinherrschenden Götter (in Christentum, Islam und Judentum) vorgenommen und diese einzeln mit den Eigenschaften verglichen, die man (angeblich) inzwischen den KI-Systemen zuschreibt.
PAGANINI schreibt also über “Allgegenwärtigkeit”, “Allwissenheit”, “Allmächtigkeit”, “Transzendenz”, “Nahbarkeit”, “Gerechtigkeit”, “Sinnstiftung” und “Fürsorglichkeit”.
Und sie tut das wiederum in einer bemerkenswerten Detailtiefe: Bevor sie diese Aspekte in der KI-Welt untersucht, greift sie noch einmal tief in die Theologie, um die Dimensionen dort zu unterfüttern.
Die von ihr herausgearbeiteten Schnittmengen zwischen alten Göttern und dem neuen KI-Gott sind durchaus nachvollziehbar und anregend.
Allerdings stimmt die Gewichtung nicht: Um sich schlaue Gedanken über die göttlichen Attribute der KI zu machen, ist es schlichtweg nicht notwendig, die jeweils betrachtete Dimension über die gesamte Religionsgeschichte zu verfolgen. An dieser Stelle bekommt man als Leser/in eher den Eindruck, dass die Autorin einfach aus der Tiefe ihres Fundus schöpfen will. Der Fragestellung des Buches hingegen nützt es eher wenig.
Ganz überzeugend ist der Ansatz von PAGANINI trotz aller Detailkenntnis und Systematik letztlich nicht. Göttlichkeit lässt sich als Summe der zugeschriebenen Attribute – also durch die hier angewandte Schablone – nicht allumfassend definieren. Vor allem wird von gläubigen Menschen Göttlichkeit mit einer emotionalen Gesamtbedeutung unterlegt, die sich nicht aus Einzelbausteinen zusammensetzen lässt. Auch der Aspekt der “letzten Erklärung” für die Erschaffung des Universums lässt sich in das KI-Modell kaum integrieren. So bleibt die spannende Frage nach dem “neuen Gott KI” letztlich doch zu einem guten Teil unbeantwortet.
Eine spannender Alternativansatz wird übrigens von dem Historiker und Bestseller-Autor HARARI vertreten: Für ihn beinhaltet die Übernahme der Sprachfähigkeit durch die aktuellen KI-Modelle letztlich auch das Potential, völlig neue Religions-Narrative zu generieren. Die so geschaffene neue Göttlichkeit würde dann nicht auf den Funktionen der KI selbst beruhen, sondern auf die Ausgestaltung neuer Glaubens-Systeme, die perfekt auf die Bedürfnisse einzelner Menschengruppen zugeschnitten sein könnten.
Es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, welche Perspektive mehr prognostische Kraft einfaltet.
Das Buch von PAGANINI ist vor allem für die Leserschaft eine Empfehlung, die bei der Reflexion über den Charakter, die Möglichkeiten und Risiken der KI gerne noch einen ausführlichen theologischen Nachhilfeunterricht mitnehmen.
Für die Meinungsbildung über das Gesamtphänomen KI liefert PAGANINI ganz sicher einen lesenswerten Beitrag.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.