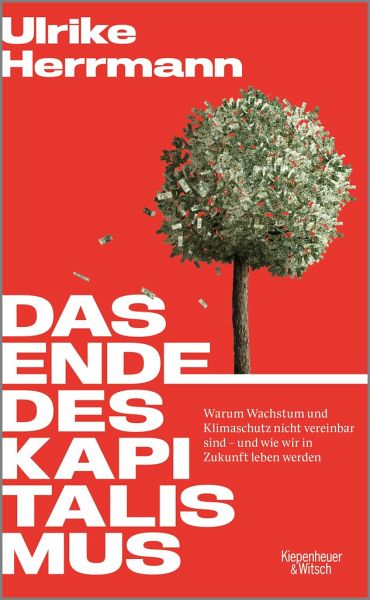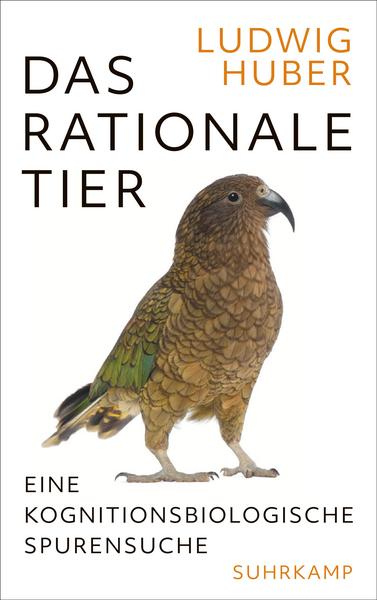Der Psychiatrie-Professor STERZER hat hier ein Buch vorgelegt, in dem – über sein Fachgebiet hinaus – vor allem Erkenntnisse aus der (kognitiven) Psychologie, der Neuro-Wissenschaften und der Evolutions-Biologie zusammenfließen.
Herausgekommen ist dabei eine sehr spezielle Mischung, deren Inhalt und Schwerpunktsetzung aus dem Titel (und Untertitel) nicht abzuleiten ist.
Das große Thema des Buches ist die gemeinsame Sicht auf das Entstehen, den Wahrheitsgehalt (die Rationalität), die Funktionalität und den evolutionären Vorteil von Überzeugungen sowohl bei gesunden, als auch bei psychisch kranken Menschen.
Ganz eindeutig liegt der psychiatrische Interessensschwerpunkt des Autors im Bereich der Schizophrenie, insbesondere bei der häufig auftretenden Wahnsymptomatik. Grob gesagt behandelt STERZER solche Wahnideen als eine Sonderform von Überzeugungen und untersucht, in welchem Umfang diese den gleichen “Gesetzmäßigkeiten” und Dynamiken unterliegen wie die ganz “normalen” Überzeugungen von Durchschnittsmenschen.
Ihn interessiert dabei insbesondere, warum (in beiden Fällen) so häufig offensichtlich “irrationale” (empirisch nicht haltbare) Überzeugungen entstehen und sich gegen massive Widerstände (andere Meinungen, Fakten, eigene Erfahrungen) behaupten.
Erklärungen findet der Autor in (allseits bekannten) kognitiven Verzerrungstendenzen, in grundlegenden neurologischen Mechanismen und in den evolutionären Überlebensvorteilen.
Die zentralen Thesen von STERZER ranken sich um die “Predictive-Processing-Theorie”, also der Sichtweise, dass unser Gehirn eine (ziemlich geniale) Vorhersage-Maschine ist, die permanent damit beschäftigt ist, aufgrund bisheriger Wahrnehmungen und Erfahrungen die zukünftigen Ereignisse (Sinnesreize) zu antizipieren. Meldungen an die höheren Hirnzentren finden nur bei Abweichungen von den Prognosen statt – was eine sehr effiziente Möglichkeit darstellt, das Gehirn zu entlasten.
Der Autor will ganz allgemein Abweichungen von der “Rationalität” enttabuisieren und entpathologisieren: Unser Säugetier-Gehirn ist nicht auf Wahrheit oder Vernunft programmiert, sondern auf Nützlichkeit für Überleben und Fortpflanzung. Da heiligt der Zweck oft die Mittel: Bestimmte Verzerrungen und Irrationalitäten können durchaus einen evolutionäre Vorteil mit sich bringen (z.B. die Konzentration auf mögliche Gefahren und das “übertriebene” Erkennen von Mustern, Kausalitäten bzw. Absichten).
In diesem Zusammenhang wirbt STERZER mehrfach zu Selbstkritik und Toleranz: Sind wirklich nur die Überzeugungen anderer Menschen mit soviel Irrationalität getränkt und so immun geben Logik und Empirie?
STERZER bietet ein hochinteressantes, didaktisch gut aufbereitetes und allgemeinverständliches Buch, das lobenswerter Weise stark interdisziplinär ausgerichtet ist. Viele Beispiele sind alltagsbezogen; Fachchinesisch wird weitgehend vermieden.
Einschränkend wäre allerdings zu bemerken, dass der Autor sich an einigen Stellen doch ein wenig festbeißt und dann auch eine gewisse Redundanz entsteht (manche Schlussfolgerungen liest bzw. hört man dann doch ein paarmal zu oft…).
Auch wird nicht für jede/n Leser/in der doch sehr starke Bezug auf (schizophrene) Wahnsymptomatik so interessant und relevant sein: Man muss schon ein gewisses Interesse an dieser psychiatrischen Störung mitbringen, um in vollem Umfang von den Ausführungen zu profitieren.
Trotzdem: “Die Illusion der Vernunft” ist ein anregender Ausflug in die Kognitionswissenschaften; da man von STERZER gut begleitet wird, ist er durchaus auch für wenig geübte Reisende geeignet.