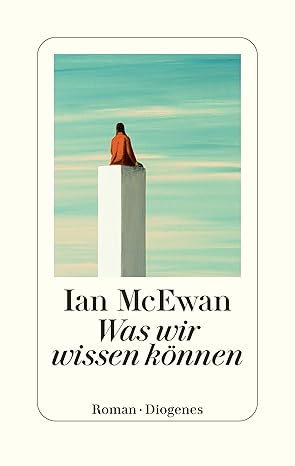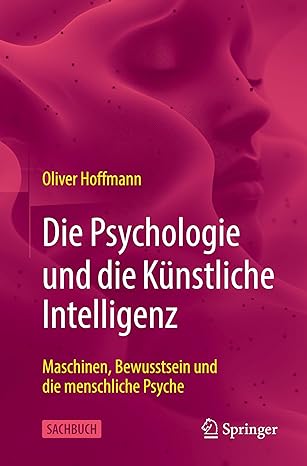
“Die Psychologie und die Künstliche Intelligenz” von Oliver Hoffmann ist ein Buch, bei dem sich sehr früh Fragen stellen, die deutlich über die üblichen Kriterien einer Sachbuchrezension hinausgehen. Es geht nicht primär um Stilfragen, nicht um Detailkritik einzelner Argumente und nicht einmal um die fachliche Qualifikation des Autors – die zumindest vom akademischen Grad unbestritten ist. Es geht um die irritierende Tatsache, dass ein etablierter Wissenschaftsverlag eine Publikation vorlegt, deren formale und inhaltliche Anlage das Lesen in einer Weise erschwert, die man als Zumutung bezeichnen muss.
Der zentrale strukturelle Eindruck dieses Buches ist Redundanz – und zwar in einem Ausmaß, das alle anderen Beurteilungskriterien überlagert. Argumente, Formulierungen und Thesen werden nahezu unverändert wiederholt, nicht nur zwischen Kapiteln, sondern innerhalb von Abschnitten und sogar von einzelnen Seiten. Bestimmte Formulierungen (“Die modernen KIs können große Datenmengen analysieren und sehr gut Muster erkennen”) kann man als Lesender nach wenigen Seiten nicht nur auswendig herbeten, sondern sogar mit großer Sicherheit für den nächsten Abschnitt vorhersagen.
Man kann sich kaum vorstellen, dass ein Leser oder eine Leserin ohne die Verpflichtung zur Rezension dieses Buch tatsächlich vollständig und aufmerksam liest, ohne irgendwann in ein bloßes Querlesen oder selektives Überfliegen zu verfallen. Redundanz kann, richtig eingesetzt, der Präzisierung dienen oder komplexe Argumente absichern. Hier jedoch erreicht sie ein groteskes Niveau, das den Text strukturell lähmt.
Dabei ist die Grundintention des Autors ausdrücklich ernst zu nehmen. Hoffmann verfolgt eine klare Mission: Er möchte dafür sensibilisieren, dass spezifisch menschliche Kompetenzen – Autonomie, Selbstreflexion, Empathie, moralische Verantwortung, Werteorientierung – nicht vorschnell einem technologischen Fortschrittsnarrativ geopfert werden. Er plädiert für eine nüchterne, kritische Einschätzung von KI-Systemen, warnt vor Überhöhung, vor einem naiven KI-Hype und vor der Illusion, maschineller Output könne menschliches Verstehen, Erleben und soziale Beziehung tatsächlich ersetzen. Diese Stoßrichtung ist legitim, wichtig und gesellschaftlich relevant. Man spürt zudem deutlich, dass der Autor auch persönlich von diesem Anliegen getragen ist.
Das Problem beginnt dort, wo Überzeugung mit Wiederholung verwechselt wird. Die zentralen Thesen dieses Buches ließen sich ohne Substanzverlust auf wenige Seiten verdichten. Die Ausweitung auf fast 300 Seiten wäre nur dann gerechtfertigt, wenn sie durch empirische Befunde, differenzierende Beispiele, Gegenargumente oder neue Perspektiven getragen würde. Genau das geschieht jedoch nicht. Stattdessen werden Behauptungen wiederholt, Fragen gestellt, um sie mit inhaltsgleichen Antworten wieder zu schließen, und Argumentationsschleifen erzeugt, die keinen zusätzlichen Erklärungswert liefern.
Besonders irritierend ist dabei die wissenschaftliche Anlage. Hoffmann zitiert außerordentlich fleißig – fast inflationär. Doch sämtliche Literaturverweise stammen aus der Zeit vor der Revolution generativer KI. Keine einzige Quelle bezieht sich auf Entwicklungen nach 2020, geschweige denn auf die Umbrüche seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022. Für ein Buch, das 2025 erschienen ist und sich explizit mit dem Verhältnis von Psychologie und KI befasst, ist diese Leerstelle nicht plausibel zu erklären. Produktionsverzögerungen reichen als Begründung nicht aus. Hier wird Aktualität nicht nur verfehlt, sondern systematisch ausgeblendet – ein Umstand, der weniger dem Autor allein als vielmehr dem Verlag angelastet werden muss.
Auch inhaltlich zeigt sich eine problematische Vereinfachung. Das dem Buch zugrunde liegende Menschenbild operiert mit einem erstaunlich unkritischen Autonomiebegriff. Implizit wird suggeriert, menschliches Handeln sei vor der KI primär das Ergebnis freier, innerer Abwägungen gewesen, während nun erstmals die Gefahr der Fremdbestimmung drohe. Historische, soziale, kulturelle und psychologische Prägungen menschlichen Verhaltens werden dabei weitgehend ignoriert. Das Ergebnis ist ein überzeichnetes Schwarz-Weiß-Schema: hier die autonome, selbstbestimmte Menschheit, dort die drohende Entfremdung durch KI-Maschinen. Eine solche Vereinfachung ist analytisch unhaltbar – und eines Psychologie-Professors nicht würdig.
Ähnlich problematisch ist der Umgang mit der Frage nach der praktischen Wirksamkeit von KI-gestützten Interaktionen. Dass KI kein Bewusstsein, kein Selbsterleben und keine emotionale Tiefe besitzt, ist korrekt – und unstrittig. Doch die entscheidende Frage lautet: Kann der simulierte soziale Output dennoch hilfreich, unterstützend oder wirksam sein? Diese Frage wird zwar gelegentlich gestellt, aber nie ernsthaft beantwortet. Stattdessen verweist der Autor immer wieder auf das fehlende Selbsterleben der Maschine – ein argumentativer Kurzschluss. Empirische Studien, die die Wirkung von KI-Dialogen auf emotionale Befindlichkeit, Verhalten oder subjektive Unterstützung untersuchen, existieren. Sie werden jedoch nicht herangezogen. Ein akademisch hochqualifizierter Autor stellt relevante Fragen, verzichtet aber auf die wissenschaftlichen Methoden, die seine Disziplin zur Beantwortung bereithält. Unerklärlich!
So bleibt am Ende ein Buch mit ehrenwertem Anliegen, aber gravierenden Schwächen: formal überladen, inhaltlich redundant, methodisch erstaunlich unscharf und wissenschaftlich unzeitgemäß. Die Psychologie und die Künstliche Intelligenz verteidigt das Menschliche mit großem Pathos – unterminiert dieses Anliegen jedoch durch argumentative Vereinfachung und verlegerische Nachlässigkeit. Für ein Sachbuch aus einem renommierten Wissenschaftsverlag ist das nicht nur zu wenig, sondern völlig unakzeptabel.
Der Bezug zu meinem Web-Projekt “WELTVERSTEHEN”:
Die größte Nähe besteht zu der Themenseite “KI“. Hier finden Sie die Einbettung in einen größeren Zusammenhang und weitere inhaltliche Hinweise bzw. Anregungen.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.