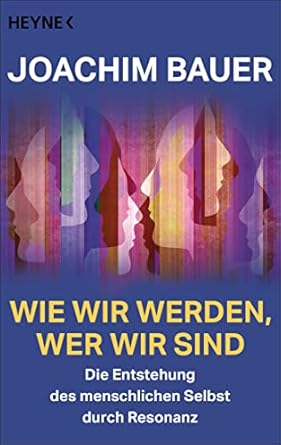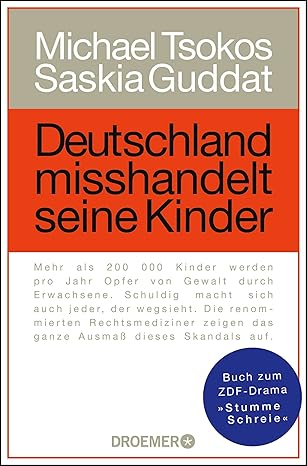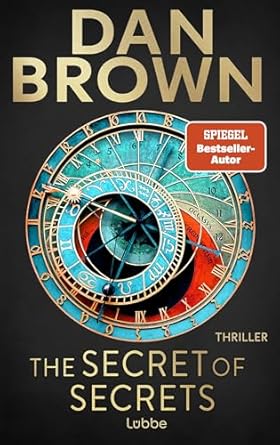
Wenn einer der weltweit erfolgreichsten Thriller-Autoren auf das Geheimnis aller Geheimnisse stößt, dann muss es schon um etwas Fundamentales gehen.
Das menschliche Bewusstsein, seine Beschaffenheit, seine Grenzen und seine – eventuelle – Beständigkeit bietet sich da ohne Zweifel an.
Der Autor schickt seine bewährte Zentralfigur (den Symbolforscher Robert Langdon) zusammen mit der aktuellen Protagonistin (der Neurowissenschaftlerin Katherine Solomon) auf einen irrwitzige 24-stündigen Parforceritt durch das geschichtsträchtige Prag der Gegenwart. Der extreme Kontrast zwischen den historischen Schauplätzen und Mythen auf der einen – und modernster Bewusstseinsforschung auf der anderen Seite -schafft eine der Grundlagen für die Dynamik des Plots.
Es geht vordergründig um ein Buch-Manuskript, für das sich auch die CIA interessiert. Der Grund dafür tritt ausgerechnet in dem Moment an die Oberfläche, an dem sich die Autorin an dem Ort eines geheimen und problematischen Forschungsprojektes aufhält.
In die sich überstürzenden Ereignisse sind auch die US-Botschafterin und einige ihrer Mitarbeiter verwickelt. Auch die Opfer einiger Experimente lernen wir kennen, ebenso den örtlich zuständigen Geheimdienst.
Man kann sich bei Thriller-Profi BROWN darauf verlassen, dass die diversen Handlungsstränge kunstvoll miteinander verwoben werden…
Kommen wir also zum Geheimnis selbst: Letztlich stellt der Roman die sehr grundlegende Frage, ob es ausreichende Anhaltspunkte dafür geben könnte, die bisherigen neurowissenschaftlichen Konzepte und Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen unseren Gehirnfunktionen und unserem Ich-Bewusstsein in Frage zu stellen.
Katherine, die ihr Forschungsinteresse zunehmend den Randphänomenen (Nahtoderfahrungen, Parapsychologie, Präkognitionen, Dissoziationsstörungen, usw.) gewidmet hat, zieht sehr weitgehende Schlussfolgerungen, die den wissenschaftlichen Mainstream weit hinter sich lassen (so vermutet sie den Sitz des Bewusstseins außerhalb unserer Gehirne).
Dan BROWN nimmt auch in diesem Roman für sich in Anspruch, sich mit seiner Story dicht an der realen Faktenlage (dem aktuellen Forschungsstand) entlang zu hangeln. Das lässt sich über weite Strecken auch nachvollziehen.
Und doch ist eine Parteinahme für die spekulativen, letztlich auch mystisch-esoterischen Hypothesen deutlich spürbar: Sie zeigt sich in der zunehmenden Überzeugung des zunächst skeptischen Robert, dass Katherine mit ihrer alternativen Weltsicht auf der richtigen Spur ist.
So stellt sich in der Gesamtbewertung die Frage, was bei einem auf spannende Unterhaltung angelegten Roman in das Urteil einfließen sollte.
Wenn ein Sachthema eine so zentrale Rolle spielt wie in diesem Roman und die etablierte Wissenschaft in der Darstellung immer stärker ins Hintertreffen gerät, kann das m.E. nicht übergangen werden. Tatsächlich wird in diesem Buch der Eindruck erweckt, als ob die etablierte Neurowissenschaft – trotz massiver gegenteiliger Belege – mehr oder weniger krampfhaft an Konzepten festhalten würde, die schon längst widerlegt worden wären.
Dabei werden reale neurophysiologische Erkenntnisse (z.B. über die Wirkung bestimmter Botenstoffe) so raffiniert mit extrem spekulativen Konzepten vermischt, dass eine fachlich unkundige Leserschaft keine Chance hat, den Übergang zu erkennen.
Hier könnte man mit gutem Grund die Grenze zur Manipulation als überschritten sehen.
Der Erfolg dieses Romans ist gesichert – die Qualitäten des Autors als Erzähler historisch eingebetteter Spannungsgeschichten steht ja außer Zweifel. Wie man hört, sind die Filmrechte schon vergeben.
Es erscheint daher um so bedauerlicher, dass sich BROWN in einer so grundlegenden Frage eher wissenschafts-skeptisch positioniert und die Nähe zu esoterischen Weltsichten in kauf nimmt.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.