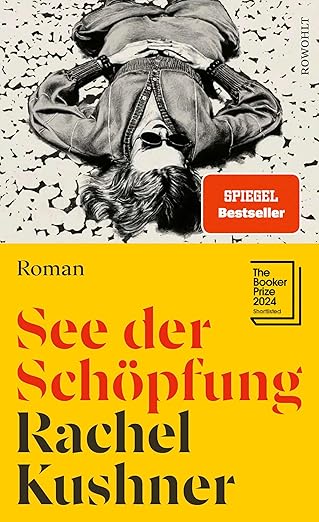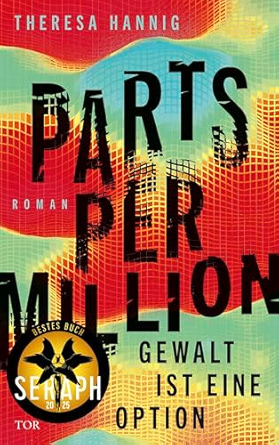Schon der poetisch aufgeladene Titel dieses Buches macht deutlich, dass es sich um eine besondere Form der Geschichtsschreibung handelt – nicht um nüchterne Wissenschaftshistorie, sondern um eine eher an Stimmungen und Personen gebundene Erzählung über ein Jahrhundert Psychotherapie. Tatsächlich nimmt uns Steve Ayan mit auf eine Zeitreise, die sich in weiten Teilen wie ein biografisches Gesellschaftspanorama liest – mit dem Zentrum im berühmten Wiener Salon Sigmund Freuds. Dass das Buch im Untertitel von einer „Bilanz des Jahrhunderts der Psychologie“ spricht, wirkt dabei fast schon wie eine bewusste Irreführung: Im Kern geht es nicht um die Psychologie als Ganzes, sondern um die Entwicklung und innere Dynamik der Psychotherapie, genauer gesagt – um die Psychoanalyse und ihre Verästelungen.
Ayan folgt der Entstehung und Differenzierung der psychoanalytischen Bewegung mit großer Detailverliebtheit. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Theorien und kulturellen Einbettungen, sondern vor allem auf den Persönlichkeiten: Freud, Jung, Adler, Reich, Rank – sie alle treten in ihren Eigenheiten, Eitelkeiten, Neurosen und Konflikten auf die Bühne. Das macht den Text lebendig, bisweilen fast romanhaft – und doch bleibt man als Leser irgendwann erstaunt zurück: Wo bleibt der Rest der Psychotherapie?
Erst spät und eher zögerlich widmet sich Ayan den anderen großen Schulen: dem amerikanischen Behaviorismus, der Gesprächs-, Gestalt- oder der Verhaltenstherapie.
Und selbst dort schlägt immer wieder der Bezug zur Analyse durch. Kaum glaubt man, der Blick wende sich nun gleichberechtigt anderen Richtungen zu, ruft Ayan doch wieder die alten psychoanalytischen Grabenkämpfe auf – oft mit einer fast klatschhaften Freude an persönlichen Dramen. Dass er dabei keineswegs als unkritischer Bewunderer Freuds auftritt, macht die Lektüre nicht weniger widersprüchlich. Im Gegenteil: Ayan formuliert sehr klar alle bekannten Schwächen der Psychoanalyse – ihre wissenschaftliche Unschärfe, die unzureichende empirische Evidenz, ihre teils sektiererischen Züge. Warum dann immer wieder diese Rückkehr zu genau dieser Welt?
Ein möglicher Grund liegt auf der Hand: Die Protagonisten der Psychoanalyse liefern mit ihren exzentrischen, oft toxischen Persönlichkeitszügen das dramatischere Material. Das verführt – aber es verzerrt auch.
An einigen Stellen gerät AYANs Auswahl der behandelten Figuren ins Groteske: Dass etwa Rudolf Steiners esoterische Denkgebäude ausführlich dargestellt werden, lässt einen am thematischen Fokus des Buches zweifeln. Fragwürdiger wird es auch, wenn zum Abschluss marxistisch inspirierte Therapiekonzepte angerissen werden – ohne echten Erkenntnisgewinn.
Doch dann kommt das Schlusskapitel – und es versöhnt. Hier gelingt AYAN ein stimmiges Resümee: Der weite Weg von Freuds Sofa bis zur modernen, pragmatischen Dienstleistungspsychotherapie wird in klarer Sprache mit einem kompetenten Blick für die großen Entwicklungslinien zusammengefasst. Trotz seiner Schlagseite bleibt Seelenzauber ein lesenswertes Buch – vor allem für Leserinnen und Leser, die ein starkes Interesse an der psychoanalytischen Welt und ihren historischen Verwicklungen mitbringen. Wer sich weniger für Persönlichkeitsgeschichten und innerprofessionelle Eitelkeiten begeistert, wird zumindest eine unterhaltsame Geschichtsstunde erleben.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.