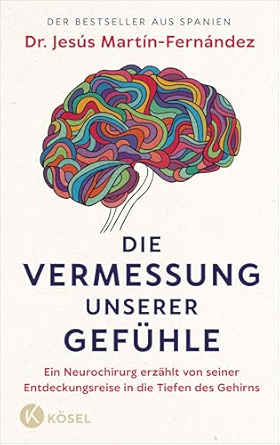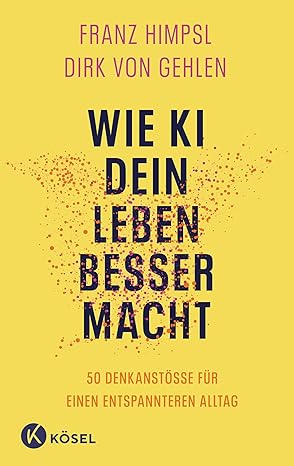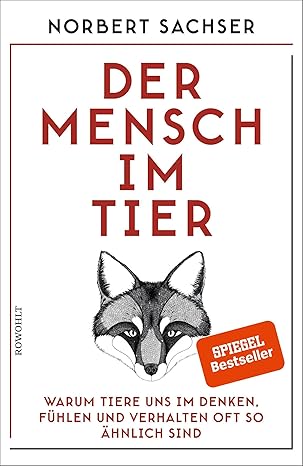
Manchmal begegnet man einem Buch, bei dem man als Rezensent eigentlich nur eines möchte: Fünf Sterne zücken und den Rest sich sparen. Norbert SACHSERs Werk “Der Mensch im Tier” ist genau so ein Fall. Es liefert eine beeindruckend umfassende und dabei wunderbar zugängliche Darstellung der verhaltensbiologischen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte – ohne akademische Hürden, aber auch ohne oberflächliche Vereinfachungen.
SACHSER gelingt hier ein Glanzstück des Wissenschaftsjournalismus: gut strukturiert, detailreich und mit einem Tiefgang, der nie ins Spezialistentum abgleitet. Stattdessen nimmt er seine Leserschaft mit auf eine Reise durch die Tierwelt, bei der sich altbekannte Vorstellungen Schritt für Schritt als überholt erweisen. Tiere, das wird hier deutlich, sind weitaus kompetenter, komplexer und – ja – auch individueller, als es noch vor wenigen Jahrzehnten selbst in Fachkreisen angenommen wurde.
Ob es um Problemlösen, Werkzeuggebrauch, Denkprozesse, Kommunikation oder moralische Intuitionen geht – SACHSER zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie sehr sich das Bild von unseren tierischen Mitgeschöpfen gewandelt hat. Dabei ist besonders faszinierend, dass diese Fähigkeiten nicht nur bei den “üblichen Verdächtigen”, also höheren Säugetieren oder Primaten, beobachtet wurden, sondern auch in der Vogelwelt – deren Intelligenz auf einem evolutionär ganz anderen Weg entstanden ist. Die Vorstellung, dass die Natur verschiedene Pfade zur Intelligenz eingeschlagen hat, ist nicht nur spannend, sondern auch erkenntnistechnisch revolutionär.
Das Buch ist reich an Beispielen für verblüffendes Tierverhalten und die kreativen Methoden, mit denen diese wissenschaftlich untersucht werden. Und erfreulicherweise verzichtet der Autor auf Selbstdarstellung oder biografische Abschweifungen – hier steht der Forschungsstand im Mittelpunkt, nicht der Forscher.
Kurz: Der Mensch im Tier ist ein vorbildlich geschriebenes Sachbuch, das man nicht nur mit Gewinn liest, sondern gerne auch ein zweites Mal aufschlägt. Für alle, die sich für Evolution, Biologie und die großen Fragen nach dem, was uns wirklich von anderen Tieren unterscheidet – oder mit ihnen verbindet –, ist dieses Buch ein echter Volltreffer.
Du möchtest das Buch kaufen?
Mach Amazon nicht noch reicher und probiere mal den “Sozialen Buchhandel”, der aus jeder Bestellung eine kleine gemeinnützige Spende macht. Der Preis für dich ändert sich dadurch nicht; die Lieferung erfolgt prompt. Klicke einfach auf das Logo.
Oder unterstütze einen kleinen Buchladen vor Ort.